Involvement of estrogen-related receptors in transcriptional response to hypoxia and growth of solid tumors
Ada Ao, Heiman Wang, Sushama Kamarajugadda, and Jianrong Lu*
Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Florida College of Medicine, P.O. Box 103633, Gainesville, FL 32610
The development of intratumoral hypoxia is a universal hallmark of rapidly growing solid tumors.
Adaptation to the hypoxic environment, which is critical for tumor cell survival and growth, is mediated primarily through a hypoxia-inducible factor (HIF)-dependent transcriptional program.
HIF activates genes that facilitate crucial adaptive mechanisms including increased glucose uptake and glycolysis and tumor angiogenesis, making it an important therapeutic target.
However, the HIF-dependent transcriptional mechanism remains incompletely understood, and targeting HIF is a difficult endeavor. Here, we show that the orphan nuclear receptor estrogen-related receptors (ERRs) physically interact with HIF and stimulate HIF-induced transcription.
Importantly, ERRs appear to be essential for HIF's function. Transcriptional activation of hypoxic genes in cells cultured under hypoxia is largely blocked by suppression of ERRs through expression of a dominant negative form of ERR or treatment with a pharmacological ERR inhibitor, diethylstilbestrol. Systematic administration of diethylstilbestrol severely diminished growth and angiogenesis of tumor xenografts in vivo.
Because nuclear receptors are outstanding targets for drug discovery, the findings not only may offer mechanistic insights into HIF-mediated transcription but also may open new avenues for targeting the HIF pathway for cancer therapy.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0711677105
DI U RITUNDU
During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. George Orwell
jeudi 29 mai 2008
mercredi 28 mai 2008
6 (mauvaises) raisons de ne pas prendre de compléments alimentaires
Supposez que l’on trouve une nouveau médicament capable de prévenir les malformations du fœtus et les complications de la grossesse, améliorer le quotient intellectuel, stimuler l‘immunité, réduire la durée des infections, améliorer le pronostic de l’infection HIV, prévenir ou retarder les maladies cardiovasculaires, prévenir de nombreux cancers, retarder la maladie d’Alzheimer, diminuer la durée des hospitalisations, réduire les comportements violents, soulager la dépression, prévenir la perte de mémoire liée à l’âge... Supposez que l’on puisse fabriquer ce médicament à un coût dérisoire. Le gouvernement s’empresserait-il de le proposer à la population, les médecins le prescriraient-ils à leurs patients ?
La réponse est non. Car nous possédons déjà un tel médicament et rien n’est fait pour en faire bénéficier celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Ce « médicament » est une association des principaux nutriments essentiels ou conditionnellement essentiels, vitamines, minéraux, acides gras, phospholipides, antioxydants… aux doses proches de celles fournies par une alimentation optimisée. Ce médicament est déjà utilisé par les personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles les plus aisées, c’est-à-dire celles qui en ont le moins besoin, puisqu’elles mangent mieux, fument moins, font de l’exercice, ont les moyens financiers de choisir un cadre de vie de qualité.
Ce « médicament » est peu ou pas utilisé par celles et ceux qui en ont besoin : les enfants et les adultes des milieux moins favorisés, les personnes âgées, les fumeurs, les gros consommateurs d’alcool, les personnes victimes de maladies chroniques, les patients hospitalisés, les personnes qui suivent un régime restrictif, celles qui mangent moins de 3 fruits et légumes par jour, celles qui évitent le soleil, qui consomment peu de poisson ou qui utilisent pour leur cuisine des corps gras déséquilibrés.
Même s’il ne faut pas en attendre des miracles, nous disposons depuis plusieurs décennies des preuves que de simples compléments alimentaires de vitamines, minéraux, acides gras, antioxydants, acides aminés… peuvent apporter des bénéfices importants et diminuer considérablement les dépenses de santé.
Alors pourquoi ne faisons-nous rien pour en faire la promotion et faciliter leur usage ?
La faute à 6 idées reçues.
Idée reçue n°1. « La nutrition, c’est l’affaire des médecins nutritionnistes »
On ne dira jamais assez combien les découvertes de la nutrition doivent à la biochimie. La plupart des réactions métaboliques de l’organisme ont été mises à jour par des biochimistes. Ce sont des biochimistes qui ont identifié, isolé et synthétisé les vitamines. Ce sont eux qui, pour l’essentiel continuent de faire vivre et développer la science nutritionnelle fondamentale, longtemps ignorés de la médecine classique quand ils n’étaient pas tout bonnement raillés.
Quand il est devenu clair il y a quarante ans après les études de Framingham et des Sept Pays que l’alimentation jouait un rôle plus important qu’on ne le croyait sur la santé, la médecine a lancé un véritable hold-up sur le discours nutritionnel. Des endocrinologues français, jusqu’alors spécialisés dans le traitement du surpoids ou du diabète, et pour lesquels la biochimie reste une abstraction, se sont baptisés « nutritionnistes », multipliant avis, conseils et diktats y compris dans les domaines où leurs connaissances sont insuffisantes. On leur doit la plupart des idées caricaturales sur lesquelles se base hélas souvent la politique de santé, elle aussi conduite par des médecins : le cholestérol conduit à l’infarctus ; les graisses alimentaires sont responsables de l’obésité ; plus on avale de calcium, plus on a des os solides… Le terme de « nutritionniste » a été si complètement capté par le milieu médical français que les premiers des « nutritionnistes », les biochimistes eux-mêmes ne peuvent plus s’en prévaloir ! (1)
Pourtant, l’enseignement de la nutrition à la faculté de médecine reste embryonnaire, se limitant à quelques heures d’études au cours desquelles sont dispensées des données parfois éculées. Par exemple, on y enseigne encore que le seul intérêt de la vitamine C, c’est de prévenir le scorbut, alors qu’il s’agit du principal antioxydant des êtres vivants. Un peu comme si dans l’organisme l’eau ne servait qu’à nous éviter d’avoir soif.
La biochimie n’est guère développée, au point que la plupart des médecins, y compris certains de ceux qui sont en charge de la politique nutritionnelle officielle seraient bien incapables de décrire correctement les réactions qui permettent l’utilisation de l’énergie des aliments.
Dans les instances officielles où biochimistes et médecins se côtoient, le fossé est parfois si profond, l’incompréhension si totale, que les dissensions sont totales. Lors des débats en 2000 à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) sur les quantités optimales et le type de graisses qu’il faudrait consommer pour être en bonne santé, de vives discussions ont opposé sur les oméga-3 biochimistes d’un côté (plus certains médecins pionniers comme le Dr Serge Renaud) aux tenants de l’Académie de médecine. Les premiers plaidaient pour que le rôle crucial de ces acides gras soit entériné par des recommandations audacieuses. Les médecins y étaient opposés. Pour une fois, les biochimistes ont eu gain de cause.
(1) Dans les pays anglo-saxons et même au Canada francophone, un « nutritionniste » est un spécialiste de nutrition, pas nécessairement médecin.
Idée reçue n° 2. « Les apports conseillés sont établis scientifiquement »
Pour s’opposer à la généralisation des compléments alimentaires, de nombreux nutritionnistes font valoir qu’une « alimentation variée et équilibrée » couvre largement les besoins en micronutriments.
C’est oublier que ces besoins sont très mal connus. A première vue, certes, les Apports nutritionnels conseillés pour la population française, publiés en 2001 par l’Afssa donnent une impression rassurante de science triomphante : vitamines, minéraux, graisses : les besoins sont fixés par tranche d’âge au milligramme près, parfois après de savants calculs. Impressionnant, mais derrière cette belle façade se cachent de multiples arrangements avec les chiffres.
Pour commencer, les études qui servent de base à ces apports conseillés ont pour la plupart été menées chez de jeunes hommes en parfaite santé et n’ont pas excédé quelques jours, voire quelques semaines. Quels sont les besoins réels des quadragénaires ? Des femmes ménopausées ? Personne n’en sait rien. Place à la calculette et aux règles de trois !
Lorsque des données assez solides existent, comme c’est le cas pour la vitamine E, encore faut-il avant de les entériner, que les besoins ainsi calculés cadrent avec le principe, déjà énonce plus haut, selon lequel l’alimentation seule doit subvenir aux besoins de la population. Un exemple de ce rationalisme scientifique est fourni par la vitamine E. En 1963, les Américains lancèrent une série d’études pour déterminer les besoins de la population. En tenant compte de tous les paramètres biologiques et épidémiologiques, il fut conclu en 1968 qu’un apport moyen de 20 mg par jour était nécessaire. Mais patatras ! Plusieurs enquêtes alimentaires menées à la fin des années 1960 et au début des années 1970 établirent que les Américains ne consommaient pas plus de 9 mg de vitamine E par jour. Avec un pragmatisme confondant, les autorités sanitaires, plutôt que de reconnaître que les Américains ne couvraient pas leurs besoins réels et qu’ils devaient pour cela faire appel à des compléments, préférèrent en 1974 diviser par 2 les apports nutritionnels conseillés. Cette valeur sortie du chapeau fut présentée comme « un apport arbitraire mais pratique. » En 2000, sous la pression des biochimistes, les apports conseillés (RDI) ont été relevés aux Etats-Unis à hauteur de 15 mg/j.
De son côté, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments a reconduit en 2001 les apports en vitamine E fixés en 1992 (12 mg/j) sans même argumenter ce choix, indiquant de manière laconique que l’objectif visé est « de proposer des apports nutritionnels, donc atteignables par l’alimentation courante. » Avec ce type de raisonnement circulaire, il devient bien sûr plus facile d’affirmer que l’alimentation « équilibrée » couvre les besoins en nutriments !
Depuis une bonne décennie les meilleurs spécialistes mondiaux de la vitamine D nous disent qu’il en faut au minimum 800 à 1000 UI (unités internationales) par jour pour garder des os solides, prévenir les cancers et décourager les maladies auto-immunes. Mais en 2001, l’Afssa a arbitrairement et sans justification scientifique divisé par deux les apports conseillés en vitamine D de 1992 - déjà très insuffisants. Depuis, les Français n’ont officiellement besoin que de… 200 UI par jour ! Il est vrai qu’une étude venait de montrer qu’en hiver 75% des citadins manquaient de cette vitamine anti-cancer, qui prévient aussi les maladies auto-immunes. Avec les nouvelles valeurs, le statut de ces Français s’est amélioré en une nuit, et surtout sans avoir recours à des compléments de vitamines.
Lorsque l’arbitraire ne préside pas à la fixation des apports conseillés, ce sont trop souvent les erreurs, les approximations et les procédures discutables qui règnent.
Dans le cas de la vitamine A, les apports réels ont été mécaniquement surestimés par l’Afssa à cause d’une erreur dans le calcul de conversion du bêta-carotène (un pigment des végétaux) en vitamine A une fois ingéré. L’Afssa estime que 6 mg de bêta-carotène donnent naissance à 1 mg de vitamine A, alors qu’il en faut en réalité 12 mg.
Pour fixer les besoins en vitamine C à 110 mg par jour, l’Afssa s’est basée sur une étude américaine de saturation plasmatique qui souffre d’un biais d’interprétation monumental, au point que son auteur, l’Américain Mark Levine, a été contraint de reconnaître son erreur. L’Afssa a aussi fait parler les données d’une étude d’intervention française, en rapprochant de manière hasardeuse deux variables si distantes que leur interprétation est particulièrement acrobatique. En réalité, si l’on tient compte de la correction apportée sur l’étude américaine et d’autres données fondamentales ignorées par l’Afssa, nous avons pu calculer que les besoins en vitamine C d’un adulte sont au minimum 5 fois supérieurs aux 110 mg retenus par l’Afssa pour les apports conseillés.
Idée reçue n°3 « Il faut attendre les résultats des études cliniques »
Pour éviter de conseiller plus largement l’usage de compléments nutritionnels, les nutritionnistes plaident la prudente ignorance du scientifique : « Nous ne connaissons, disent-ils, ni les conséquences réelles des déficits nutritionnels, ni les effets des compléments. Conduisons des études cliniques, et quand tous les résultats seront connus, nous ferons des recommandations. » Cet argument paraît frappé au coin du bon sens, et c’est la raison pour laquelle il fait si souvent mouche dans les cercles gouvernementaux, les médias et l’opinion. Seuls des irresponsables, en effet, accepteraient de se passer de preuves avant de faire des recommandations qui engagent la santé. Cela d’autant plus, renchérissent les nutritionnistes, que dans le passé, deux études ont montré que des compléments alimentaires de bêta-carotène, au lieu de prévenir le cancer, l’ont favorisé.
En réalité, cette attitude « prudente » est profondément choquante sur le plan de la santé publique.
Le grand public doit savoir qu’on ne peut pas appliquer à la recherche en nutrition exactement les mêmes méthodes que celles de l’industrie pharmaceutique. Les études cliniques, qui consistent à comparer sur des volontaires les effets d’une molécule et ceux d’un placebo, ont été inventées et formatées pour les besoins de la recherche pharmaceutique, qui met au point des médicaments. Dans certains cas, elles peuvent être adaptées à l’étude d’un nutriment - par exemple, les acides gras de poisson en prévention de l’infarctus ou en traitement de la dépression. Vouloir systématiser leur usage en matière de recherche nutritionnelle témoigne d’une attitude réductionniste. Non seulement est-il pratiquement et financièrement impossible de mettre sur pied les innombrables études cliniques qui permettraient d’examiner, et ce pendant plusieurs années, les effets d’un nutriment isolé sur chaque sous-groupe de la population, mais ce n’est pas toujours souhaitable.
Dans l’alimentation, les nutriments interagissent en permanence sous leur forme naturelle. Le cas le plus connu est celui des antioxydants, qui s’épaulent en permanence au niveau cellulaire.
Pour avoir oublié cette règle simple, l’Institut National du Cancer des Etats-Unis a conduit dans les années 1990 deux grandes études cliniques aux résultats catastrophiques : la Beta Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) et l’Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study (ATBC) qui ciblaient deux populations à haut risque de cancer du poumon.
- L’étude CARET, conduite auprès de 18 500 fumeurs, ex-fumeurs ou travailleurs exposés à l’amiante a été arrêtée prématurément lorsque les chercheurs ont réalisé que le groupe qui prenait un supplément quotidien de 30 mg de bêta-carotène et de 25 000 UI de vitamine A avait un risque de cancer du poumon augmenté de 28 % par rapport au placebo.
- Dans l’étude ATBC, conduite auprès de 29 1330 fumeurs, le risque de cancer du poumon a été augmenté de 16 % avec la prise quotidienne de 20 mg de bêta-carotène.
En dépit de leur impact très négatif sur l’opinion, ces deux études nous ont apporté la confirmation qu’un nutriment n’est pas un médicament.
D’abord, l’environnement peut altérer le comportement d’un nutriment. Dans le cas des études CARET et ATBC, il est clair que l’intensité du tabagisme a modifié les effets préventifs du bêta-carotène. Dans l’étude ATBC, le bêta-carotène a augmenté le risque de cancer chez les gros fumeurs (20 cigarettes ou plus par jour), mais n’a entraîné aucun risque supplémentaire chez ceux qui fumaient moins de 20 cigarettes quotidiennes. Dans l’étude CARET, le risque de cancer est augmenté chez les personnes qui fumaient au commencement de l’étude (+ 42%), mais pas chez les gros fumeurs qui avaient arrêté le tabac avant le début de l’étude. Par rapport à ceux qui prenaient un placebo, ces anciens fumeurs qui prenaient du bêta-carotène et de la vitamine A ont vu leur risque de cancer baisser de 20% (même si le résultat n’est pas significatif sur le plan statistique).
Ensuite, il faut être très prudent lorsque l’on s’avise de transposer directement les processus de la recherche pharmaceutique à la recherche en nutrition. Dans la mesure du possible, les études cliniques devraient tester les substances mêmes que l’on trouve à l’état naturel dans notre alimentation. Le bêta-carotène synthétique employé dans les études CARET et ATBC se comporte différemment du bêta-carotène naturel. Par exemple, à la dose de 20 mg/jour comme dans l’étude ATBC, il entraîne une augmentation de 400% de la teneur du plasma en bêta-carotène.
Les mêmes difficultés se retrouvent dans le cas de la vitamine E. Le terme de vitamine E désigne deux familles de substances, les tocophérols et les tocotriénols, dont il existe 2x4 isomères. La plupart des études portant sur la vitamine E utilisent un seul de ces isomères, l’alpha-tocophérol, de surcroît sous sa forme synthétique, le d-l-alpha-tocophérol - alors qu’un mélange d’isomères naturels serait plus approprié.
Enfin, les investigateurs doivent impérativement tenir compte de la synergie entre nutriments. Alors que les études portant sur des nutriments isolés ont donné des résultats décevants, celles qui proposaient une association de plusieurs substances nutritionnelles ont le plus souvent permis de diminuer les risques de maladie.
Si les études cliniques sont fréquemment inadaptées à la recherche nutritionnelle, comment alors prouver l’intérêt des compléments alimentaires ? En accordant à l’épidémiologie un poids au moins aussi important qu’aux études cliniques. L’épidémiologie, dont il existe de nombreuses variantes, consiste à observer des groupes de la population, par exemple ceux qui ont peu de vitamine D, et à comparer leur santé à celle de ceux qui en ont beaucoup. Il existe aujourd’hui des dizaines de milliers d’études épidémiologiques qui, prises collectivement, permettent raisonnablement de dire que les déficits nutritionnels doivent être corrigés, par une meilleure alimentation, l’enrichissement des aliments ou les compléments alimentaires, au risque de conduire à des troubles graves. Ces troubles mettent des décennies à se déclarer en raison de nos capacités de résilience, c’est-à-dire l’extraordinaire aptitude du corps humain à s’accommoder, à court et moyen terme, de conditions biologiques défavorables (comme dans la famine ou au contraire dans l’obésité). Voilà pourquoi, la plupart du temps, les déficits en vitamines, minéraux, acides gras, ne se manifestent pas par des symptômes marqués, qui mettent l’existence en danger. Mais par une altération discrète des processus biochimiques qui, à la longue, lorsque l’organisme a épuisé ses capacités de résilience, conduisent à la maladie : dépression, trouble cognitif, infarctus, cancer, ostéoporose, diabète, Parkinson…
Faut-il attendre les résultats d’études cliniques aléatoires pour conseiller le grand public, au risque de voir les déficits faire le lit des maladies chroniques ? Voici ce qu’en pense Gladys Block (université de Californie, Berkeley), une autorité mondiale dans le domaine de la nutrition : « Certains chercheurs prétendent que les essais cliniques représentent le seul standard « en or » pour tester des hypothèses concernant des facteurs alimentaires et la santé. Avec les autorités de la santé, ils soutiennent que tout jugement scientifique et toute allégation santé doivent être suspendus tant que les hypothèses ne sont pas prouvées par une étude clinique. Je soutiens que, pour la plupart des hypothèses qui ont une signification large en matière de santé publique (...), les études cliniques sont à la fois inappropriées et souvent impossibles. (...) Seul l’examen solide des preuves obtenues en laboratoire et par l’épidémiologie peut nous aider à approcher des réponses. (...) Pour de nombreuses questions concernant le rôle des facteurs nutritionnels dans la prévention primaire des maladies à long délai d’apparition, la seule réponse se trouve dans une synthèse intelligente. »
Voici ce qu’en dit Jeffrey Blumberg, Directeur du laboratoire de recherche sur les antioxydants, Directeur associé du Centre de recherche en nutrition humaine à l’université Tufts de Boston : « Les nutritionnistes qui conseillent d’attendre ont tort. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de dire au public : "Donnez-nous encore 10 ou 20 ans, parce qu'on veut être absolument sûrs." Ce n'est ni fair-play, ni acceptable. Refuser de communiquer au grand public l'information que nous possédons est une erreur, en particulier au moment où nous sommes confrontés à une grave crise de la santé publique pour ce qui est des maladies chroniques. Nous avons suffisamment d'informations aujourd'hui pour faire des recommandations. (...) Le moment est venu de prendre la parole et de dire que le bénéfice des suppléments est hautement probable et qu'il n'y a pas de risque de toxicité. »
Même son de cloche à l’Ecole de santé publique de Harvard (Boston), où l’on déclare, par la voix du docteur Meir Stampfer : « Il est possible de faire des recommandations à partir des données provenant des études de prévention secondaires et des études de progression de ces maladies, plutôt que d’attendre les résultats d’études de prévention primaires, qui seront massives, onéreuses et longues. »
Idée reçue n°4. « Une alimentation variée et équilibrée couvre tous nos besoins »
L’idée que l’alimentation ne couvre pas les besoins en nutriments essentiels d’une partie importante de la population est insupportable à de nombreux médecins, et inconcevables par les responsables politiques et les hauts fonctionnaires. La réglementation française impose d’ailleurs aux fabricants de compléments alimentaires de dire que « seule une alimentation variée et équilibrée est susceptible de couvrir les besoins quotidiens. »
Bizarrement, aucune des enquêtes conduites depuis 20 ans n’a réussi à prouver que l’alimentation des Français les met à l’abri de déficits micronutritionnels. Les chercheurs considèrent qu’une personne dont l’alimentation ne couvre pas les deux tiers des apports conseillés en micronutriments court un risque élevé de déficit. Selon des enquêtes françaises récentes, c’est le cas de 38% des femmes et 18,7% des hommes pour la vitamine E, 27% des femmes et 17% des hommes pour la vitamine C, 23% des femmes et 18% des hommes pour le magnésium, 57 à 79% des femmes et 25 à 50% des hommes pour le zinc… Pour le minéral-clé qu’est le sélénium, la consommation moyenne en France ne correspond qu’à 60% des apports conseillés. Enfin, 75% des adultes vivant en ville manquent en hiver de vitamine D.
D’un côté, on continue de clamer qu’une alimentation équilibrée et variée couvre les besoins en vitamines et minéraux, de l’autre on entérine dans les faits la situation de déficit nutritionnel dans laquelle se trouvent les Français, en donnant des suppléments de vitamines D et K aux nouveaux-nés, des suppléments de vitamines B9 et de fer aux femmes enceintes, des suppléments de fluor aux enfants, des suppléments d’iode à toute la population (par l’enrichissement du sel), des suppléments de vitamine D et de calcium aux plus de 60 ans, etc.
« J’ai le sentiment, dit à juste titre le Pr Pr Jeffrey Blumberg que la France a un problème avec la nutrition : de très nombreux responsables, de très nombreux médecins ne veulent pas admettre que l’alimentation française n’est pas parfaite. »
Aux Etats-Unis, comme dans d’autres pays, on l’a depuis longtemps admis. Des suppléments sont ajoutés depuis 1970 aux aliments de base. Ce sont actuellement les vitamines B1, B3, B6, B9, le fer, l’iode, et les vitamines A et D. En 1992, le Service de santé publique des Etats-Unis a recommandé que toutes les femmes en âge d’avoir des enfants reçoivent 400 μg de vitamine B9 par jour. En 1996, la FDA a autorisé les fabricants d’aliments et de suppléments riches en acide folique à faire état de la prévention des malformations du foetus par la consommation de ces aliments et de ces suppléments. Depuis janvier 1998, la FDA a mis en place un programme d’enrichissement en vitamine B9 des céréales, du pain et des pâtes, vendus sur le territoire américain.
En 1992, le Royaume-Uni a recommandé que toutes les femmes qui « envisagent une grossesse mangent plus d’aliments riches en folates [vitamine B9] et prennent un complément quotidien apportant 400 μg d’acide folique. »
Cette stratégie de complémentation des aliments de base a des implications importantes en terme de santé publique, puisque 25% des nutriments-clés ingérés par les Américains sont apportés par le seul enrichissement des aliments. La complémentation contribue donc de façon conséquente à l’équilibre nutritionnel de la population. « S’il était éliminé, a calculé le Pr Paul Lachance (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey), des cas de malnutrition apparaîtraient, même dans des pays industrialisés comme les Etats-Unis. »
En 1999, un chercheur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Nicole Darmon, a fait appel à la programmation linéaire pour déterminer le type d’alimentation que les Françaises et les Français doivent adopter pour obtenir vitamines et minéraux aux quantités fixées par les apports nutritionnels conseillés (ANC). Sa conclusion : il est impossible de recevoir ces doses optimales de vitamines et de minéraux sauf à consommer des aliments, comme les abats, qui sont dédaignés par plus de 70% de la population. La couverture des besoins est particulièrement difficile pour les vitamines B1, B6, E et D. Côté minéraux, les apports en magnésium, fer, zinc, cuivre sont problématiques. Un exemple ? Pour atteindre les ANC, une femme adulte devrait consommer chaque jour 1,25 kg de fruits et légumes frais.
De surcroît, il existe aujourd’hui de sérieux doutes sur la teneur réelle en vitamines et minéraux des fruits et légumes du commerce. Selon une enquête publiée en 2006 en Grande-Bretagne, sur 27 variétés de légumes, leur teneur moyenne en potassium aurait baissé de 16% entre 1940 et 1991 ; en magnésium de 24% ; en calcium de 46% ; en fer de 27% ; en cuivre de 76%. Pour les 17 variétés de fruits étudiées, les baisses moyennes atteindraient 19% pour le potassium, 16% pour le magnésium, 16% pour le calcium, 24% pour le fer, 20% pour le cuivre.
Une enquête du même type conduite aux Etats-Unis a trouvé qu’entre 1975 et 2001, les fruits et légumes avaient pour la plupart vu leur teneur en vitamines et minéraux chuter. Les épinards auraient perdu 45% de leur vitamine C, le maïs 33% de son calcium, le chou-fleur la moitié de sa vitamine B1, l’ananas, les deux-tiers de son calcium pour ne citer que quelques exemples.
Idée reçue n° 5. « Les compléments alimentaires détournent d’une alimentation équilibrée »
Pour mieux souligner les limites des compléments alimentaires, les nutritionnistes opposent volontiers la capsule à l’aliment. « Une capsule, répètent-t-il, ne peut remplacer la richesse d’un aliment. » Comme s’il fallait choisir entre les unes et les autres. C’est oublier que les compléments alimentaires n’ont pas pour but de se substituer à l’alimentation, mais, par définition, de la compléter. Personne ne conteste la supériorité de l’aliment sur le complément nutritionnel : 10 mg d’un comprimé de bêta-carotène ne valent pas les mêmes 10 mg contenus dans une carotte, avec ses autres caroténoïdes, son potassium, ses fibres, ses vitamines, etc... Mais on peut manger ses carottes râpées et prendre aussi par précaution un complément de vitamines avec du bêta-carotène. Pour certains nutritionnistes, la prise de compléments aurait un « effet pervers sur le comportement alimentaire » dans la mesure où les gens seraient « détournés » d’une alimentation saine.
Mais cette affirmation ne repose sur rien. En fait, elle est démentie par la totalité des enquêtes menées auprès des utilisateurs de compléments alimentaires. Ces personnes ont en général des modes de vie plus vertueux et une alimentation plus saine que les non utilisateurs. L’étude NHANES II, et d’autres études américaines ont montré que les utilisateurs de suppléments reçoivent plus de nutriments par l’alimentation. Dans l’étude NHIS de 1992, l’alimentation des utilisateurs de suppléments était plus pauvre en graisses, plus riche en fibres et en plusieurs vitamines et minéraux que celle des non-utilisateurs.
Une étude conduite auprès de centenaires et de personnes âgées a montré que les utilisateurs de suppléments étaient physiquement plus actifs, ils consommaient aussi moins de sel, de graisses, de cholestérol, de sucre et de caféine que les non utilisateurs. Dans une étude conduite à Hawaï auprès de 4 654 hommes âgés de plus de 68 ans, les utilisateurs de suppléments étaient moins obèses que les non utilisateurs, ils étaient plus actifs, dormaient moins, fumaient moins, buvaient moins d’alcool et consommaient moins de caféine.
Une étude britannique sur 13 800 femmes confirme que celles qui font appel à des suppléments ont un mode de vie plus sain que celles qui n’y font pas appel. La prise de suppléments est associée au fait d’être végétarien, de consommer régulièrement du poisson, de consommer plus de fruits et légumes, de pratiquer une activité physique et de boire peu d’alcool. Les fumeuses, les femmes dont l’IMC est supérieur à 25 étaient celles qui consommaient le moins de suppléments. « Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle l’usage de compléments alimentaires est associé à un mode de vie plus sain et un apport nutritionnel adéquat, » concluent les auteurs.
Une étude récente publiée dans l’American Journal of Epidémiology et qui portait sur 100 000 adultes a confirmé que “l’usage de supplements a tendance à augmenter avec l’âge, le niveau d’éducation, l’activité physique, la consommation de fruits et de fibres, et diminuer avec l’obésité, le tabagisme et la consommation de graisses. Les personnes dont le mode de vie est le plus sain étaient celles qui avaient le plus de chance de consommer des suppléments. »
Toutes les études conduites à ce jour s’accordent sur un point : les utilisateurs de suppléments sont pratiquement toujours ceux qui mangent le plus sainement.
6. « Les compléments alimentaires ont peut-être un intérêt mais certainement pas à doses élevées »
La glucosamine et la chondroïtine, deux substances naturelles, ont été données à dose élevée sous la forme de compléments alimentaires à des patients souffrant d’arthrose dans près de 20 études cliniques portant sur près de 3 000 personnes. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec un placebo ou un médicament.
Dès 2001, des chercheurs ont étudié les résultats groupés de 16 études de ce type : la glucosamine était supérieure au placebo dans 12 des 13 essais cliniques en double aveugle. Quatre essais comparatifs ont conclu que la glucosamine est au moins aussi efficace que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques (AINS). [1]
En juillet 2003, des chercheurs belges ont publié dans le journal de référence Archives of Internal Medicine une analyse en cumul des résultats de 15 études portant sur la glucosamine et la chondroïtine sulfate. Cette nouvelle analyse conclut que la preuve est dorénavant apportée que ces substances naturelles diminuent la douleur, la rigidité des articulations et améliorent la qualité de vie des personnes qui les ont prises. Elles arrêtent ou freinent considérablement la progression de la maladie et peuvent stimuler la fabrication de nouveau cartilage.
La glucosamine et la chondroïtine améliorent en moyenne de 50% les symptômes de l’arthrose. Elles divisent par deux le risque de voir diminuer l’espace articulaire (un signe de progression de la maladie), comme l’a montré une étude de 2001 publiée dans le Lancet. [2]
Comment agissent-elles ? Les suppléments de glucosamine et de chondroïtine épargnent aux cellules de l’articulation, les chondrocytes, la tâche devenue quasi-impossible de fabriquer du cartilage (protéoglycanes) à partir du glucose. En apportant des compléments « tout prêts » comme la glucosamine et la chondroïtine sulfate, on permet aux cellules de se remettre à synthétiser du cartilage. Les suppléments de glucosamine par voie orale servent à fabriquer directement l’épine dorsale des protéoglycanes du cartilage ;
la glucosamine sert aussi à fabriquer les brins de glycosaminoglycanes attachés à cette épine dorsale ; les suppléments de chondroïtine sulfate par voie orale sont directement incorporés dans les protéoglycanes.
Les exemples de la glucosamine et de la chondroïtine montrent qu’on peut apporter un bénéfice en ravivant le métabolisme. Même les personnes en bonne santé peuvent attendre des bénéfices d’une relance du métabolisme par les compléments alimentaires, à des doses hors de portée de l’alimentation.
Un tiers des mutations qui affectent un gène diminuent l’affinité d’une enzyme pour son coenzyme et ralentissent donc la réaction enzymatique. Un grand nombre de personnes qui souffrent des quelques 50 maladies génétiques dues à des enzymes défectueux pourraient être améliorées par des doses élevées de la ou des vitamines du groupe B qui agissent comme coenzyme de l’enzyme en cause. De même, de très nombreux polymorphismes qui portent sur un nucléotide isolé, dans lequel l’acide aminé variant diminue la liaison du coenzyme et donc l’activité enzymatique, pourraient être corrigés en augmentant la concentration cellulaire du cofacteur grâce à un complément alimentaire fortement dosé. C’est le cas dans les polymorphismes de la méthylènetétrahydrofolate réductase (risque de maladies cardiovasculaires), de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (anémie hémolytique), de la quinone oxydoréductase (cancers), de l’aldéhyde déshydrogénase (Alzheimer).
[1] Towheed TE : Glucosamine therapy for treating osteoarthritis.Cochrane Database Syst Rev 2001;(1):CD002946..
[2] Reginster JY : Long-term effects of glucosamine sulfate on osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled trial. Lancet 2001, 357:251-256.
http://www.lanutrition.fr/6-(mauvaises)-raisons-de-ne-pas-prendre-de-compléments-alimentaires-a-2543.html
La réponse est non. Car nous possédons déjà un tel médicament et rien n’est fait pour en faire bénéficier celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Ce « médicament » est une association des principaux nutriments essentiels ou conditionnellement essentiels, vitamines, minéraux, acides gras, phospholipides, antioxydants… aux doses proches de celles fournies par une alimentation optimisée. Ce médicament est déjà utilisé par les personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles les plus aisées, c’est-à-dire celles qui en ont le moins besoin, puisqu’elles mangent mieux, fument moins, font de l’exercice, ont les moyens financiers de choisir un cadre de vie de qualité.
Ce « médicament » est peu ou pas utilisé par celles et ceux qui en ont besoin : les enfants et les adultes des milieux moins favorisés, les personnes âgées, les fumeurs, les gros consommateurs d’alcool, les personnes victimes de maladies chroniques, les patients hospitalisés, les personnes qui suivent un régime restrictif, celles qui mangent moins de 3 fruits et légumes par jour, celles qui évitent le soleil, qui consomment peu de poisson ou qui utilisent pour leur cuisine des corps gras déséquilibrés.
Même s’il ne faut pas en attendre des miracles, nous disposons depuis plusieurs décennies des preuves que de simples compléments alimentaires de vitamines, minéraux, acides gras, antioxydants, acides aminés… peuvent apporter des bénéfices importants et diminuer considérablement les dépenses de santé.
Alors pourquoi ne faisons-nous rien pour en faire la promotion et faciliter leur usage ?
La faute à 6 idées reçues.
Idée reçue n°1. « La nutrition, c’est l’affaire des médecins nutritionnistes »
On ne dira jamais assez combien les découvertes de la nutrition doivent à la biochimie. La plupart des réactions métaboliques de l’organisme ont été mises à jour par des biochimistes. Ce sont des biochimistes qui ont identifié, isolé et synthétisé les vitamines. Ce sont eux qui, pour l’essentiel continuent de faire vivre et développer la science nutritionnelle fondamentale, longtemps ignorés de la médecine classique quand ils n’étaient pas tout bonnement raillés.
Quand il est devenu clair il y a quarante ans après les études de Framingham et des Sept Pays que l’alimentation jouait un rôle plus important qu’on ne le croyait sur la santé, la médecine a lancé un véritable hold-up sur le discours nutritionnel. Des endocrinologues français, jusqu’alors spécialisés dans le traitement du surpoids ou du diabète, et pour lesquels la biochimie reste une abstraction, se sont baptisés « nutritionnistes », multipliant avis, conseils et diktats y compris dans les domaines où leurs connaissances sont insuffisantes. On leur doit la plupart des idées caricaturales sur lesquelles se base hélas souvent la politique de santé, elle aussi conduite par des médecins : le cholestérol conduit à l’infarctus ; les graisses alimentaires sont responsables de l’obésité ; plus on avale de calcium, plus on a des os solides… Le terme de « nutritionniste » a été si complètement capté par le milieu médical français que les premiers des « nutritionnistes », les biochimistes eux-mêmes ne peuvent plus s’en prévaloir ! (1)
Pourtant, l’enseignement de la nutrition à la faculté de médecine reste embryonnaire, se limitant à quelques heures d’études au cours desquelles sont dispensées des données parfois éculées. Par exemple, on y enseigne encore que le seul intérêt de la vitamine C, c’est de prévenir le scorbut, alors qu’il s’agit du principal antioxydant des êtres vivants. Un peu comme si dans l’organisme l’eau ne servait qu’à nous éviter d’avoir soif.
La biochimie n’est guère développée, au point que la plupart des médecins, y compris certains de ceux qui sont en charge de la politique nutritionnelle officielle seraient bien incapables de décrire correctement les réactions qui permettent l’utilisation de l’énergie des aliments.
Dans les instances officielles où biochimistes et médecins se côtoient, le fossé est parfois si profond, l’incompréhension si totale, que les dissensions sont totales. Lors des débats en 2000 à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) sur les quantités optimales et le type de graisses qu’il faudrait consommer pour être en bonne santé, de vives discussions ont opposé sur les oméga-3 biochimistes d’un côté (plus certains médecins pionniers comme le Dr Serge Renaud) aux tenants de l’Académie de médecine. Les premiers plaidaient pour que le rôle crucial de ces acides gras soit entériné par des recommandations audacieuses. Les médecins y étaient opposés. Pour une fois, les biochimistes ont eu gain de cause.
(1) Dans les pays anglo-saxons et même au Canada francophone, un « nutritionniste » est un spécialiste de nutrition, pas nécessairement médecin.
Idée reçue n° 2. « Les apports conseillés sont établis scientifiquement »
Pour s’opposer à la généralisation des compléments alimentaires, de nombreux nutritionnistes font valoir qu’une « alimentation variée et équilibrée » couvre largement les besoins en micronutriments.
C’est oublier que ces besoins sont très mal connus. A première vue, certes, les Apports nutritionnels conseillés pour la population française, publiés en 2001 par l’Afssa donnent une impression rassurante de science triomphante : vitamines, minéraux, graisses : les besoins sont fixés par tranche d’âge au milligramme près, parfois après de savants calculs. Impressionnant, mais derrière cette belle façade se cachent de multiples arrangements avec les chiffres.
Pour commencer, les études qui servent de base à ces apports conseillés ont pour la plupart été menées chez de jeunes hommes en parfaite santé et n’ont pas excédé quelques jours, voire quelques semaines. Quels sont les besoins réels des quadragénaires ? Des femmes ménopausées ? Personne n’en sait rien. Place à la calculette et aux règles de trois !
Lorsque des données assez solides existent, comme c’est le cas pour la vitamine E, encore faut-il avant de les entériner, que les besoins ainsi calculés cadrent avec le principe, déjà énonce plus haut, selon lequel l’alimentation seule doit subvenir aux besoins de la population. Un exemple de ce rationalisme scientifique est fourni par la vitamine E. En 1963, les Américains lancèrent une série d’études pour déterminer les besoins de la population. En tenant compte de tous les paramètres biologiques et épidémiologiques, il fut conclu en 1968 qu’un apport moyen de 20 mg par jour était nécessaire. Mais patatras ! Plusieurs enquêtes alimentaires menées à la fin des années 1960 et au début des années 1970 établirent que les Américains ne consommaient pas plus de 9 mg de vitamine E par jour. Avec un pragmatisme confondant, les autorités sanitaires, plutôt que de reconnaître que les Américains ne couvraient pas leurs besoins réels et qu’ils devaient pour cela faire appel à des compléments, préférèrent en 1974 diviser par 2 les apports nutritionnels conseillés. Cette valeur sortie du chapeau fut présentée comme « un apport arbitraire mais pratique. » En 2000, sous la pression des biochimistes, les apports conseillés (RDI) ont été relevés aux Etats-Unis à hauteur de 15 mg/j.
De son côté, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments a reconduit en 2001 les apports en vitamine E fixés en 1992 (12 mg/j) sans même argumenter ce choix, indiquant de manière laconique que l’objectif visé est « de proposer des apports nutritionnels, donc atteignables par l’alimentation courante. » Avec ce type de raisonnement circulaire, il devient bien sûr plus facile d’affirmer que l’alimentation « équilibrée » couvre les besoins en nutriments !
Depuis une bonne décennie les meilleurs spécialistes mondiaux de la vitamine D nous disent qu’il en faut au minimum 800 à 1000 UI (unités internationales) par jour pour garder des os solides, prévenir les cancers et décourager les maladies auto-immunes. Mais en 2001, l’Afssa a arbitrairement et sans justification scientifique divisé par deux les apports conseillés en vitamine D de 1992 - déjà très insuffisants. Depuis, les Français n’ont officiellement besoin que de… 200 UI par jour ! Il est vrai qu’une étude venait de montrer qu’en hiver 75% des citadins manquaient de cette vitamine anti-cancer, qui prévient aussi les maladies auto-immunes. Avec les nouvelles valeurs, le statut de ces Français s’est amélioré en une nuit, et surtout sans avoir recours à des compléments de vitamines.
Lorsque l’arbitraire ne préside pas à la fixation des apports conseillés, ce sont trop souvent les erreurs, les approximations et les procédures discutables qui règnent.
Dans le cas de la vitamine A, les apports réels ont été mécaniquement surestimés par l’Afssa à cause d’une erreur dans le calcul de conversion du bêta-carotène (un pigment des végétaux) en vitamine A une fois ingéré. L’Afssa estime que 6 mg de bêta-carotène donnent naissance à 1 mg de vitamine A, alors qu’il en faut en réalité 12 mg.
Pour fixer les besoins en vitamine C à 110 mg par jour, l’Afssa s’est basée sur une étude américaine de saturation plasmatique qui souffre d’un biais d’interprétation monumental, au point que son auteur, l’Américain Mark Levine, a été contraint de reconnaître son erreur. L’Afssa a aussi fait parler les données d’une étude d’intervention française, en rapprochant de manière hasardeuse deux variables si distantes que leur interprétation est particulièrement acrobatique. En réalité, si l’on tient compte de la correction apportée sur l’étude américaine et d’autres données fondamentales ignorées par l’Afssa, nous avons pu calculer que les besoins en vitamine C d’un adulte sont au minimum 5 fois supérieurs aux 110 mg retenus par l’Afssa pour les apports conseillés.
Idée reçue n°3 « Il faut attendre les résultats des études cliniques »
Pour éviter de conseiller plus largement l’usage de compléments nutritionnels, les nutritionnistes plaident la prudente ignorance du scientifique : « Nous ne connaissons, disent-ils, ni les conséquences réelles des déficits nutritionnels, ni les effets des compléments. Conduisons des études cliniques, et quand tous les résultats seront connus, nous ferons des recommandations. » Cet argument paraît frappé au coin du bon sens, et c’est la raison pour laquelle il fait si souvent mouche dans les cercles gouvernementaux, les médias et l’opinion. Seuls des irresponsables, en effet, accepteraient de se passer de preuves avant de faire des recommandations qui engagent la santé. Cela d’autant plus, renchérissent les nutritionnistes, que dans le passé, deux études ont montré que des compléments alimentaires de bêta-carotène, au lieu de prévenir le cancer, l’ont favorisé.
En réalité, cette attitude « prudente » est profondément choquante sur le plan de la santé publique.
Le grand public doit savoir qu’on ne peut pas appliquer à la recherche en nutrition exactement les mêmes méthodes que celles de l’industrie pharmaceutique. Les études cliniques, qui consistent à comparer sur des volontaires les effets d’une molécule et ceux d’un placebo, ont été inventées et formatées pour les besoins de la recherche pharmaceutique, qui met au point des médicaments. Dans certains cas, elles peuvent être adaptées à l’étude d’un nutriment - par exemple, les acides gras de poisson en prévention de l’infarctus ou en traitement de la dépression. Vouloir systématiser leur usage en matière de recherche nutritionnelle témoigne d’une attitude réductionniste. Non seulement est-il pratiquement et financièrement impossible de mettre sur pied les innombrables études cliniques qui permettraient d’examiner, et ce pendant plusieurs années, les effets d’un nutriment isolé sur chaque sous-groupe de la population, mais ce n’est pas toujours souhaitable.
Dans l’alimentation, les nutriments interagissent en permanence sous leur forme naturelle. Le cas le plus connu est celui des antioxydants, qui s’épaulent en permanence au niveau cellulaire.
Pour avoir oublié cette règle simple, l’Institut National du Cancer des Etats-Unis a conduit dans les années 1990 deux grandes études cliniques aux résultats catastrophiques : la Beta Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) et l’Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study (ATBC) qui ciblaient deux populations à haut risque de cancer du poumon.
- L’étude CARET, conduite auprès de 18 500 fumeurs, ex-fumeurs ou travailleurs exposés à l’amiante a été arrêtée prématurément lorsque les chercheurs ont réalisé que le groupe qui prenait un supplément quotidien de 30 mg de bêta-carotène et de 25 000 UI de vitamine A avait un risque de cancer du poumon augmenté de 28 % par rapport au placebo.
- Dans l’étude ATBC, conduite auprès de 29 1330 fumeurs, le risque de cancer du poumon a été augmenté de 16 % avec la prise quotidienne de 20 mg de bêta-carotène.
En dépit de leur impact très négatif sur l’opinion, ces deux études nous ont apporté la confirmation qu’un nutriment n’est pas un médicament.
D’abord, l’environnement peut altérer le comportement d’un nutriment. Dans le cas des études CARET et ATBC, il est clair que l’intensité du tabagisme a modifié les effets préventifs du bêta-carotène. Dans l’étude ATBC, le bêta-carotène a augmenté le risque de cancer chez les gros fumeurs (20 cigarettes ou plus par jour), mais n’a entraîné aucun risque supplémentaire chez ceux qui fumaient moins de 20 cigarettes quotidiennes. Dans l’étude CARET, le risque de cancer est augmenté chez les personnes qui fumaient au commencement de l’étude (+ 42%), mais pas chez les gros fumeurs qui avaient arrêté le tabac avant le début de l’étude. Par rapport à ceux qui prenaient un placebo, ces anciens fumeurs qui prenaient du bêta-carotène et de la vitamine A ont vu leur risque de cancer baisser de 20% (même si le résultat n’est pas significatif sur le plan statistique).
Ensuite, il faut être très prudent lorsque l’on s’avise de transposer directement les processus de la recherche pharmaceutique à la recherche en nutrition. Dans la mesure du possible, les études cliniques devraient tester les substances mêmes que l’on trouve à l’état naturel dans notre alimentation. Le bêta-carotène synthétique employé dans les études CARET et ATBC se comporte différemment du bêta-carotène naturel. Par exemple, à la dose de 20 mg/jour comme dans l’étude ATBC, il entraîne une augmentation de 400% de la teneur du plasma en bêta-carotène.
Les mêmes difficultés se retrouvent dans le cas de la vitamine E. Le terme de vitamine E désigne deux familles de substances, les tocophérols et les tocotriénols, dont il existe 2x4 isomères. La plupart des études portant sur la vitamine E utilisent un seul de ces isomères, l’alpha-tocophérol, de surcroît sous sa forme synthétique, le d-l-alpha-tocophérol - alors qu’un mélange d’isomères naturels serait plus approprié.
Enfin, les investigateurs doivent impérativement tenir compte de la synergie entre nutriments. Alors que les études portant sur des nutriments isolés ont donné des résultats décevants, celles qui proposaient une association de plusieurs substances nutritionnelles ont le plus souvent permis de diminuer les risques de maladie.
Si les études cliniques sont fréquemment inadaptées à la recherche nutritionnelle, comment alors prouver l’intérêt des compléments alimentaires ? En accordant à l’épidémiologie un poids au moins aussi important qu’aux études cliniques. L’épidémiologie, dont il existe de nombreuses variantes, consiste à observer des groupes de la population, par exemple ceux qui ont peu de vitamine D, et à comparer leur santé à celle de ceux qui en ont beaucoup. Il existe aujourd’hui des dizaines de milliers d’études épidémiologiques qui, prises collectivement, permettent raisonnablement de dire que les déficits nutritionnels doivent être corrigés, par une meilleure alimentation, l’enrichissement des aliments ou les compléments alimentaires, au risque de conduire à des troubles graves. Ces troubles mettent des décennies à se déclarer en raison de nos capacités de résilience, c’est-à-dire l’extraordinaire aptitude du corps humain à s’accommoder, à court et moyen terme, de conditions biologiques défavorables (comme dans la famine ou au contraire dans l’obésité). Voilà pourquoi, la plupart du temps, les déficits en vitamines, minéraux, acides gras, ne se manifestent pas par des symptômes marqués, qui mettent l’existence en danger. Mais par une altération discrète des processus biochimiques qui, à la longue, lorsque l’organisme a épuisé ses capacités de résilience, conduisent à la maladie : dépression, trouble cognitif, infarctus, cancer, ostéoporose, diabète, Parkinson…
Faut-il attendre les résultats d’études cliniques aléatoires pour conseiller le grand public, au risque de voir les déficits faire le lit des maladies chroniques ? Voici ce qu’en pense Gladys Block (université de Californie, Berkeley), une autorité mondiale dans le domaine de la nutrition : « Certains chercheurs prétendent que les essais cliniques représentent le seul standard « en or » pour tester des hypothèses concernant des facteurs alimentaires et la santé. Avec les autorités de la santé, ils soutiennent que tout jugement scientifique et toute allégation santé doivent être suspendus tant que les hypothèses ne sont pas prouvées par une étude clinique. Je soutiens que, pour la plupart des hypothèses qui ont une signification large en matière de santé publique (...), les études cliniques sont à la fois inappropriées et souvent impossibles. (...) Seul l’examen solide des preuves obtenues en laboratoire et par l’épidémiologie peut nous aider à approcher des réponses. (...) Pour de nombreuses questions concernant le rôle des facteurs nutritionnels dans la prévention primaire des maladies à long délai d’apparition, la seule réponse se trouve dans une synthèse intelligente. »
Voici ce qu’en dit Jeffrey Blumberg, Directeur du laboratoire de recherche sur les antioxydants, Directeur associé du Centre de recherche en nutrition humaine à l’université Tufts de Boston : « Les nutritionnistes qui conseillent d’attendre ont tort. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de dire au public : "Donnez-nous encore 10 ou 20 ans, parce qu'on veut être absolument sûrs." Ce n'est ni fair-play, ni acceptable. Refuser de communiquer au grand public l'information que nous possédons est une erreur, en particulier au moment où nous sommes confrontés à une grave crise de la santé publique pour ce qui est des maladies chroniques. Nous avons suffisamment d'informations aujourd'hui pour faire des recommandations. (...) Le moment est venu de prendre la parole et de dire que le bénéfice des suppléments est hautement probable et qu'il n'y a pas de risque de toxicité. »
Même son de cloche à l’Ecole de santé publique de Harvard (Boston), où l’on déclare, par la voix du docteur Meir Stampfer : « Il est possible de faire des recommandations à partir des données provenant des études de prévention secondaires et des études de progression de ces maladies, plutôt que d’attendre les résultats d’études de prévention primaires, qui seront massives, onéreuses et longues. »
Idée reçue n°4. « Une alimentation variée et équilibrée couvre tous nos besoins »
L’idée que l’alimentation ne couvre pas les besoins en nutriments essentiels d’une partie importante de la population est insupportable à de nombreux médecins, et inconcevables par les responsables politiques et les hauts fonctionnaires. La réglementation française impose d’ailleurs aux fabricants de compléments alimentaires de dire que « seule une alimentation variée et équilibrée est susceptible de couvrir les besoins quotidiens. »
Bizarrement, aucune des enquêtes conduites depuis 20 ans n’a réussi à prouver que l’alimentation des Français les met à l’abri de déficits micronutritionnels. Les chercheurs considèrent qu’une personne dont l’alimentation ne couvre pas les deux tiers des apports conseillés en micronutriments court un risque élevé de déficit. Selon des enquêtes françaises récentes, c’est le cas de 38% des femmes et 18,7% des hommes pour la vitamine E, 27% des femmes et 17% des hommes pour la vitamine C, 23% des femmes et 18% des hommes pour le magnésium, 57 à 79% des femmes et 25 à 50% des hommes pour le zinc… Pour le minéral-clé qu’est le sélénium, la consommation moyenne en France ne correspond qu’à 60% des apports conseillés. Enfin, 75% des adultes vivant en ville manquent en hiver de vitamine D.
D’un côté, on continue de clamer qu’une alimentation équilibrée et variée couvre les besoins en vitamines et minéraux, de l’autre on entérine dans les faits la situation de déficit nutritionnel dans laquelle se trouvent les Français, en donnant des suppléments de vitamines D et K aux nouveaux-nés, des suppléments de vitamines B9 et de fer aux femmes enceintes, des suppléments de fluor aux enfants, des suppléments d’iode à toute la population (par l’enrichissement du sel), des suppléments de vitamine D et de calcium aux plus de 60 ans, etc.
« J’ai le sentiment, dit à juste titre le Pr Pr Jeffrey Blumberg que la France a un problème avec la nutrition : de très nombreux responsables, de très nombreux médecins ne veulent pas admettre que l’alimentation française n’est pas parfaite. »
Aux Etats-Unis, comme dans d’autres pays, on l’a depuis longtemps admis. Des suppléments sont ajoutés depuis 1970 aux aliments de base. Ce sont actuellement les vitamines B1, B3, B6, B9, le fer, l’iode, et les vitamines A et D. En 1992, le Service de santé publique des Etats-Unis a recommandé que toutes les femmes en âge d’avoir des enfants reçoivent 400 μg de vitamine B9 par jour. En 1996, la FDA a autorisé les fabricants d’aliments et de suppléments riches en acide folique à faire état de la prévention des malformations du foetus par la consommation de ces aliments et de ces suppléments. Depuis janvier 1998, la FDA a mis en place un programme d’enrichissement en vitamine B9 des céréales, du pain et des pâtes, vendus sur le territoire américain.
En 1992, le Royaume-Uni a recommandé que toutes les femmes qui « envisagent une grossesse mangent plus d’aliments riches en folates [vitamine B9] et prennent un complément quotidien apportant 400 μg d’acide folique. »
Cette stratégie de complémentation des aliments de base a des implications importantes en terme de santé publique, puisque 25% des nutriments-clés ingérés par les Américains sont apportés par le seul enrichissement des aliments. La complémentation contribue donc de façon conséquente à l’équilibre nutritionnel de la population. « S’il était éliminé, a calculé le Pr Paul Lachance (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey), des cas de malnutrition apparaîtraient, même dans des pays industrialisés comme les Etats-Unis. »
En 1999, un chercheur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Nicole Darmon, a fait appel à la programmation linéaire pour déterminer le type d’alimentation que les Françaises et les Français doivent adopter pour obtenir vitamines et minéraux aux quantités fixées par les apports nutritionnels conseillés (ANC). Sa conclusion : il est impossible de recevoir ces doses optimales de vitamines et de minéraux sauf à consommer des aliments, comme les abats, qui sont dédaignés par plus de 70% de la population. La couverture des besoins est particulièrement difficile pour les vitamines B1, B6, E et D. Côté minéraux, les apports en magnésium, fer, zinc, cuivre sont problématiques. Un exemple ? Pour atteindre les ANC, une femme adulte devrait consommer chaque jour 1,25 kg de fruits et légumes frais.
De surcroît, il existe aujourd’hui de sérieux doutes sur la teneur réelle en vitamines et minéraux des fruits et légumes du commerce. Selon une enquête publiée en 2006 en Grande-Bretagne, sur 27 variétés de légumes, leur teneur moyenne en potassium aurait baissé de 16% entre 1940 et 1991 ; en magnésium de 24% ; en calcium de 46% ; en fer de 27% ; en cuivre de 76%. Pour les 17 variétés de fruits étudiées, les baisses moyennes atteindraient 19% pour le potassium, 16% pour le magnésium, 16% pour le calcium, 24% pour le fer, 20% pour le cuivre.
Une enquête du même type conduite aux Etats-Unis a trouvé qu’entre 1975 et 2001, les fruits et légumes avaient pour la plupart vu leur teneur en vitamines et minéraux chuter. Les épinards auraient perdu 45% de leur vitamine C, le maïs 33% de son calcium, le chou-fleur la moitié de sa vitamine B1, l’ananas, les deux-tiers de son calcium pour ne citer que quelques exemples.
Idée reçue n° 5. « Les compléments alimentaires détournent d’une alimentation équilibrée »
Pour mieux souligner les limites des compléments alimentaires, les nutritionnistes opposent volontiers la capsule à l’aliment. « Une capsule, répètent-t-il, ne peut remplacer la richesse d’un aliment. » Comme s’il fallait choisir entre les unes et les autres. C’est oublier que les compléments alimentaires n’ont pas pour but de se substituer à l’alimentation, mais, par définition, de la compléter. Personne ne conteste la supériorité de l’aliment sur le complément nutritionnel : 10 mg d’un comprimé de bêta-carotène ne valent pas les mêmes 10 mg contenus dans une carotte, avec ses autres caroténoïdes, son potassium, ses fibres, ses vitamines, etc... Mais on peut manger ses carottes râpées et prendre aussi par précaution un complément de vitamines avec du bêta-carotène. Pour certains nutritionnistes, la prise de compléments aurait un « effet pervers sur le comportement alimentaire » dans la mesure où les gens seraient « détournés » d’une alimentation saine.
Mais cette affirmation ne repose sur rien. En fait, elle est démentie par la totalité des enquêtes menées auprès des utilisateurs de compléments alimentaires. Ces personnes ont en général des modes de vie plus vertueux et une alimentation plus saine que les non utilisateurs. L’étude NHANES II, et d’autres études américaines ont montré que les utilisateurs de suppléments reçoivent plus de nutriments par l’alimentation. Dans l’étude NHIS de 1992, l’alimentation des utilisateurs de suppléments était plus pauvre en graisses, plus riche en fibres et en plusieurs vitamines et minéraux que celle des non-utilisateurs.
Une étude conduite auprès de centenaires et de personnes âgées a montré que les utilisateurs de suppléments étaient physiquement plus actifs, ils consommaient aussi moins de sel, de graisses, de cholestérol, de sucre et de caféine que les non utilisateurs. Dans une étude conduite à Hawaï auprès de 4 654 hommes âgés de plus de 68 ans, les utilisateurs de suppléments étaient moins obèses que les non utilisateurs, ils étaient plus actifs, dormaient moins, fumaient moins, buvaient moins d’alcool et consommaient moins de caféine.
Une étude britannique sur 13 800 femmes confirme que celles qui font appel à des suppléments ont un mode de vie plus sain que celles qui n’y font pas appel. La prise de suppléments est associée au fait d’être végétarien, de consommer régulièrement du poisson, de consommer plus de fruits et légumes, de pratiquer une activité physique et de boire peu d’alcool. Les fumeuses, les femmes dont l’IMC est supérieur à 25 étaient celles qui consommaient le moins de suppléments. « Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle l’usage de compléments alimentaires est associé à un mode de vie plus sain et un apport nutritionnel adéquat, » concluent les auteurs.
Une étude récente publiée dans l’American Journal of Epidémiology et qui portait sur 100 000 adultes a confirmé que “l’usage de supplements a tendance à augmenter avec l’âge, le niveau d’éducation, l’activité physique, la consommation de fruits et de fibres, et diminuer avec l’obésité, le tabagisme et la consommation de graisses. Les personnes dont le mode de vie est le plus sain étaient celles qui avaient le plus de chance de consommer des suppléments. »
Toutes les études conduites à ce jour s’accordent sur un point : les utilisateurs de suppléments sont pratiquement toujours ceux qui mangent le plus sainement.
6. « Les compléments alimentaires ont peut-être un intérêt mais certainement pas à doses élevées »
La glucosamine et la chondroïtine, deux substances naturelles, ont été données à dose élevée sous la forme de compléments alimentaires à des patients souffrant d’arthrose dans près de 20 études cliniques portant sur près de 3 000 personnes. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec un placebo ou un médicament.
Dès 2001, des chercheurs ont étudié les résultats groupés de 16 études de ce type : la glucosamine était supérieure au placebo dans 12 des 13 essais cliniques en double aveugle. Quatre essais comparatifs ont conclu que la glucosamine est au moins aussi efficace que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques (AINS). [1]
En juillet 2003, des chercheurs belges ont publié dans le journal de référence Archives of Internal Medicine une analyse en cumul des résultats de 15 études portant sur la glucosamine et la chondroïtine sulfate. Cette nouvelle analyse conclut que la preuve est dorénavant apportée que ces substances naturelles diminuent la douleur, la rigidité des articulations et améliorent la qualité de vie des personnes qui les ont prises. Elles arrêtent ou freinent considérablement la progression de la maladie et peuvent stimuler la fabrication de nouveau cartilage.
La glucosamine et la chondroïtine améliorent en moyenne de 50% les symptômes de l’arthrose. Elles divisent par deux le risque de voir diminuer l’espace articulaire (un signe de progression de la maladie), comme l’a montré une étude de 2001 publiée dans le Lancet. [2]
Comment agissent-elles ? Les suppléments de glucosamine et de chondroïtine épargnent aux cellules de l’articulation, les chondrocytes, la tâche devenue quasi-impossible de fabriquer du cartilage (protéoglycanes) à partir du glucose. En apportant des compléments « tout prêts » comme la glucosamine et la chondroïtine sulfate, on permet aux cellules de se remettre à synthétiser du cartilage. Les suppléments de glucosamine par voie orale servent à fabriquer directement l’épine dorsale des protéoglycanes du cartilage ;
la glucosamine sert aussi à fabriquer les brins de glycosaminoglycanes attachés à cette épine dorsale ; les suppléments de chondroïtine sulfate par voie orale sont directement incorporés dans les protéoglycanes.
Les exemples de la glucosamine et de la chondroïtine montrent qu’on peut apporter un bénéfice en ravivant le métabolisme. Même les personnes en bonne santé peuvent attendre des bénéfices d’une relance du métabolisme par les compléments alimentaires, à des doses hors de portée de l’alimentation.
Un tiers des mutations qui affectent un gène diminuent l’affinité d’une enzyme pour son coenzyme et ralentissent donc la réaction enzymatique. Un grand nombre de personnes qui souffrent des quelques 50 maladies génétiques dues à des enzymes défectueux pourraient être améliorées par des doses élevées de la ou des vitamines du groupe B qui agissent comme coenzyme de l’enzyme en cause. De même, de très nombreux polymorphismes qui portent sur un nucléotide isolé, dans lequel l’acide aminé variant diminue la liaison du coenzyme et donc l’activité enzymatique, pourraient être corrigés en augmentant la concentration cellulaire du cofacteur grâce à un complément alimentaire fortement dosé. C’est le cas dans les polymorphismes de la méthylènetétrahydrofolate réductase (risque de maladies cardiovasculaires), de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (anémie hémolytique), de la quinone oxydoréductase (cancers), de l’aldéhyde déshydrogénase (Alzheimer).
[1] Towheed TE : Glucosamine therapy for treating osteoarthritis.Cochrane Database Syst Rev 2001;(1):CD002946..
[2] Reginster JY : Long-term effects of glucosamine sulfate on osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled trial. Lancet 2001, 357:251-256.
http://www.lanutrition.fr/6-(mauvaises)-raisons-de-ne-pas-prendre-de-compléments-alimentaires-a-2543.html
Clinton, You Invoked a Political Nightmare ..... We cannot forgive you this !
Friday 23 May 2008
by: Keith Olbermann,
MSNBC Countdown
US Democratic presidential candidate Senator Hillary Clinton (D-NY) recently referred to RFK's assassination as a reason for staying in the race. (Photo: Matt Mahurin / WDCPix)
Olbermann: Referencing RFK's assassination as a reason for staying in the race is unforgiveable.
Asked if her continuing fight for the nomination against Senator Obama hurts the Democratic party, Sen. Hillary Clinton replied, "I don't. Because again, I've been around long enough. You know, my husband did not wrap up the nomination in 1992 until he won the California primary somewhere in the middle of June, right? We all remember Bobby Kennedy was assassinated in June in California.
You know, I just don't understand it. You know, there's lots of speculation about why it is. "
The comments were recorded and we showed them to you earlier and they are online as we speak.
She actually said those words.
Those words, Senator?
You actually invoked the nightmare of political assassination.
You actually invoked the specter of an inspirational leader, at the seeming moment of triumph, for himself and a battered nation yearning to breathe free, silenced forever.
You actually used the word "assassination" in the middle of a campaign with a loud undertone of racial hatred - and gender hatred - and political hatred.
You actually used the word "assassination" in a time when there is a fear, unspoken but vivid and terrible, that our again-troubled land and fractured political landscape might target a black man running for president.
Or a white man.
Or a white woman!
You actually used those words, in this America, Senator, while running against an African-American against whom the death threats started the moment he declared his campaign?
You actually used those words, in this America, Senator, while running to break your "greatest glass ceiling" and claiming there are people who would do anything to stop you?
You!
Senator - never mind the implications of using the word "assassination" in any connection to Senator Obama...
What about you?
You cannot say this!
The references, said her spokesperson, were not, in any way, weighted.
The allusions, said Mo Uh-leathee, are, "...historical examples of the nominating process going well into the summer and any reading into it beyond that would be inaccurate and outrageous."
I'm sorry.
There is no inaccuracy.
Not for a moment does any rational person believe Senator Clinton is actually hoping for the worst of all political calamities.
Yet the outrage belongs, not to Senator Clinton or her supporters, but to every other American.
Firstly, she has previously bordered on the remarks she made today...
Then swerved back from them and the awful skid they represented.
She said, in an off-camera interview with Time on March 6, "Primary contests used to last a lot longer. We all remember the great tragedy of Bobby Kennedy being assassinated in June in L.A. My husband didn't wrap up the nomination in 1992 until June, also in California. Having a primary contest go through June is nothing particularly unusual. We will see how it unfolds as we go forward over the next three to four months."
In retrospect, we failed her when we did not call her out, for that remark, dry and only disturbing, in a magazine's pages. But somebody obviously warned her of the danger of that rhetoric:
After the Indiana primary, on May 7, she told supporters at a Washington hotel:
"Sometimes you gotta calm people down a little bit. But if you look at successful presidential campaigns, my husband did not get the nomination until June of 1992. I remember tragically when Senator Kennedy won California near the end of that process."
And at Shepherdstown, West Virginia, on the same day, she referenced it again:
"You know, I remember very well what happened in the California primary in 1968 as, you know, Senator Kennedy won that primary."
On March 6th she had said "assassinated."
By May 7 she had avoided it. Today... she went back to an awful well. There is no good time to recall the awful events of June 5th, 1968, of Senator Bobby Kennedy, happy and alive - perhaps, for the first time since his own brother's death in Dallas in 1963... Galvanized to try to lead this nation back from one of its darkest eras... Only to fall victim to the same surge that took that brother, and Martin Luther King... There is no good time to recall this. But certainly to invoke it, two weeks before the exact 40th anniversary of the assassination, is an insensitive and heartless thing.
And certainly to invoke it, three days after the awful diagnosis, and heart-breaking prognosis, for Senator Ted Kennedy, is just as insensitive, and just as heartless. And both actions, open a door wide into the soul of somebody who seeks the highest office in this country, and through that door shows something not merely troubling, but frightening. And politically inexplicable.
What, Senator, do you suppose would happen if you withdrew from the campaign, and Senator Obama formally became the presumptive nominee, and then suddenly left the scene? It doesn't even have to be the "dark curse upon the land" you mentioned today, Senator. Nor even an issue of health. He could simply change his mind... Or there could unfold that perfect-storm scandal your people have often referenced, even predicted. Maybe he could get a better offer from some other, wiser, country. What happens then, Senator? You are not allowed back into the race? Your delegates and your support vanish? The Democrats don't run anybody for President?
What happens, of course, is what happened when the Democrats' vice presidential choice, Senator Thomas Eagleton of Missouri, had to withdraw from the ticket, in 1972 after it proved he had not been forthcoming about previous mental health treatments. George McGovern simply got another vice president.
Senator, as late as the late summer of 1864 the Republicans were talking about having a second convention, to withdraw Abraham Lincoln's re-nomination and choose somebody else because until Sherman took Atlanta in September it looked like Lincoln was going to lose to George McClellan.
You could theoretically suspend your campaign, Senator.
There's plenty of time and plenty of historical precedent, Senator, in case you want to come back in, if something bad should happen to Senator Obama. Nothing serious, mind you.
It's just like you said, "We all remember Bobby Kennedy was assassinated in June in California."
Since those awful words in Sioux Falls, and after the condescending, buck-passing statement from her spokesperson, Senator Clinton has made something akin to an apology, without any evident recognition of the true trauma she has inflicted.
"I was discussing the Democratic primary history, and in the course of that discussion mentioned the campaigns both my husband and Senator Kennedy waged California in June in 1992 and 1968," she said in Brandon, South Dakota. "I was referencing those to make the point that we have had nomination primary contests that go into June. That's a historic fact.
"The Kennedys have been much on my mind the last days because of Senator Kennedy. I regret that if my referencing that moment of trauma for our entire nation, particularly for the Kennedy family was in any way offensive, I certainly had no intention of that whatsoever."
"My view is that we have to look to the past and to our leaders who have inspired us and give us a lot to live up to and I'm honored to hold Senator Kennedy's seat in the United States Senate in the state of New York and have the highest regard for the entire Kennedy family. Thanks. Not a word about the inappropriateness of referencing assassination.
Not a word about the inappropriateness of implying - whether it was intended or not - that she was hanging around waiting for somebody to try something terrible.
Not a word about Senator Obama.
Not a word about Senator McCain.
Not: I'm sorry...
Not: I apologize...
Not: I blew it...
Not: please forgive me.
God knows, Senator, in this campaign, this nation has had to forgive you, early and often...
And despite your now traditional position of the offended victim, the nation has forgiven you.
We have forgiven you your insistence that there have been widespread calls for you to end your campaign, when such calls had been few. We have forgiven you your misspeaking about Martin Luther King's relative importance to the Civil Rights movement.
We have forgiven you your misspeaking about your under-fire landing in Bosnia.
We have forgiven you insisting Michigan's vote wouldn't count and then claiming those who would not count it were Un-Democratic.
We have forgiven you pledging to not campaign in Florida and thus disenfranchise voters there, and then claim those who stuck to those rules were as wrong as those who defended slavery or denied women the vote.
We have forgiven you the photos of Osama Bin Laden in an anti-Obama ad...
We have forgiven you fawning over the fairness of Fox News while they were still calling you a murderer.
We have forgiven you accepting Richard Mellon Scaife's endorsement and then laughing as you described his "deathbed conversion."
We have forgiven you quoting the electoral predictions of Boss Karl Rove.
We have forgiven you the 3 a.m. Phone Call commercial.
We have forgiven you President Clinton's disparaging comparison of the Obama candidacy to Jesse Jackson's.
We have forgiven you Geraldine Ferraro's national radio interview suggesting Obama would not still be in the race had he been a white man.
We have forgiven you the dozen changing metrics and the endless self-contradictions of your insistence that your nomination is mathematically probable rather than a statistical impossibility.
We have forgiven you your declaration of some primary states as counting and some as not.
We have forgiven you exploiting Jeremiah Wright in front of the editorial board of the lunatic-fringe Pittsburgh Tribune-Review.
We have forgiven you exploiting William Ayers in front of the debate on ABC.
We have forgiven you for boasting of your "support among working, hard-working Americans, white Americans"...
We have even forgiven you repeatedly praising Senator McCain at Senator Obama's expense, and your own expense, and the Democratic ticket's expense.
But Senator, we cannot forgive you this.
"You know, my husband did not wrap up the nomination in 1992 until he won the California primary somewhere in the middle of June, right? We all remember Bobby Kennedy was assassinated in June in California."
We cannot forgive you this - not because it is crass and low and unfeeling and brutal.
This is unforgivable, because this nation's deepest shame, its most enduring horror, its most terrifying legacy, is political assassination.
Lincoln.
Garfield.
McKinley.
Kennedy.
Martin Luther King.
Robert Kennedy.
And, but for the grace of the universe or the luck of the draw, Reagan, Ford, Truman, Nixon, Andrew Jackson, both Roosevelts, even George Wallace.
The politics of this nation is steeped enough in blood, Senator Clinton, you cannot and must not invoke that imagery! Anywhere! At any time!
And to not appreciate, immediately - to still not appreciate tonight - just what you have done... is to reveal an incomprehension of the America you seek to lead.
This, Senator, is too much.
Because a senator - a politician - a person - who can let hang in mid-air the prospect that she might just be sticking around in part, just in case the other guy gets shot - has no business being, and no capacity to be, the President of the United States.
Good night and good luck.
Morals ? Which Morals ? When Survival of the Jewish People Is at Stake, There’s No Place for Morals
When Survival of the Jewish People Is at Stake, There’s No Place for Morals
Opinion
By Yehezkel Dror
Thu. May 15, 2008
Forward
There is little disagreement that every Jewish leader, organization, community and individual has a duty to help ensure the continuity of the Jewish people. But in a world where the long-term existence of the Jewish state is far from certain, the imperative to exist inevitably gives rise to difficult questions, foremost among them this: When the survival of the Jewish people conflicts with the morals of the Jewish people, is existence worthwhile, or even possible?
Physical existence, I would argue, must come first. No matter how moral a society aspires to be, physical existence must take precedent.
Clear external and internal dangers threaten the very existence of Israel as a Jewish state. It is very likely that the collapse of Israel or the loss of its Jewish nature would undermine the existence of the Jewish people as a whole. And even given the existence of a Jewish state, less clear but no less fateful dangers threaten the long-term sustainable existence of the Diaspora.
When the requirements of existence conflict with other values, therefore, realpolitik should be given priority. From the threat of a disastrous conflict with Islamist actors such as Iran, to the necessity of maintaining distinctions between “us” and “others” in order to limit assimilation, this imperative ought to guide policymakers.
Regrettably, human history refutes the idealistic claim that in order to exist for long, a state, society or people has to be moral. Given the foreseeable realities of the 21st century and beyond, harsh choices are unavoidable, with requirements of existence often contradicting other important values.
Some might argue that putting existence first may be counter-productive in terms of existence itself, because what may be regarded as immoral action can undermine external and internal support essential for existence. However, the calculus of realpolitik gives primacy to existence, leaving limited room for ethical considerations. The unfortunate reality is that the Jewish people may be faced with tragic choices in which important values have to be sacrificed for even more important ones.
Responsible decisions in such difficult situations require clear recognition of the involved moral issues, careful pondering of all relevant values and acceptance of responsibility for one’s autonomous judgment. They also demand an effort to reduce to a minimum the violation of moral values.
Nonetheless, when faced with such choices, the Jewish people ought not be captivated by political correctness and other thinking-repressing fashions. When it comes to China, for example, efforts to strengthen the rising superpower’s ties to the Jewish people should trump moral-minded campaigns to alter Beijing’s domestic policies and handling of Tibet. The same goes for Turkey: Given its crucial peacemaking role in the Middle East, discussion of whether the Ottomans committed genocide against the Armenians ought to be left to historians, preferably non-Jewish ones.
That is not necessarily to condone China’s policies, or to deny Armenian history. Rather, it is to recognize that however just such moral stances may or may not be, the Jewish people must give primacy to existence.
What is required is a priori pondering of values, so as to have guidelines ready for judgment in specific contexts and under crisis conditions. The overall issue is whether the imperative for the Jewish people to exist is a categorical one overriding nearly all other values, or one among many imperatives of similar standing. Given both the history and current situation of the Jewish people, I would argue that the imperative to assure existence is of overriding moral weight.
Let us leave aside reliance on transcendental arguments, biblical commands and sayings of the sages, all of which are open to various interpretations. The justification for giving priority to the needs of existence is four-fold.
First, the Jewish people has an inherent right to exist, just as any other people or civilization.
Second, a people that has been regularly persecuted for 2,000 years is entitled morally, in terms of distributive justice, to be very tough in taking care of its existence, including the moral right and even duty to kill and be killed if this is essential for assuring existence — even at the cost of other values and to other people. This argument is all the more compelling in light of the unprecedented killing only a few decades ago of a third of the Jewish people — mass murder that was supported directly and indirectly, or at least not prevented when possible, by large parts of the civilized world.
Third, given the history of Judaism and the Jewish people, there is a good chance that we will continue to make much-needed ethical contributions to humanity. However, in order to do so we require a stable existence.
Fourth, the State of Israel is the only democratic country whose very existence is endangered by deeply hostile actors, again, without the world taking decisive countermeasures. This justifies — indeed, requires — measures that would be not only unnecessary but also potentially immoral in other circumstances.
The Jewish people should give much more weight to the imperative to assure existence than to other values. There are, of course, limits; nothing can justify initiating genocide. But with the few exceptions where being killed and destroyed is better than transgressing against absolute and total norms, assuring the existence of the Jewish people, including a Jewish State of Israel, should be valued as a top priority.
Thus, if the security of Israel is significantly strengthened by good relations with Turkey and China, but in some views Turkey is guilty of genocide in the past against the Armenians and China of now repressing Tibetans and domestic opposition, Jewish leaders and organizations should support Turkey and China, or at least remain neutral when it comes to their affairs. At a minimum, Jewish leaders should not join the chorus of liberal and humanitarian actors condemning Turkey and China.
Similarly, Jewish leaders should support harsh measures against terrorists who potentially endanger Jews, even at the cost of human rights and humanitarian law. And if the threat is sufficiently grave, the use of weapons of mass destruction by Israel would be justified if likely to be necessary for assuring the state’s survival, the bitter price of large number of killed innocent civilians notwithstanding.
To be sure, there is much room for debate on what is really required for existence. Giving priority to the imperative to exist does not imply supporting each and every policy of Israel. Indeed, the opposite is true: Diaspora leaders, organizations and individuals have a duty to criticize Israeli policies that in their view endanger the Jewish state and the Jewish people’s existence, along with an obligation to propose alternative existence-assuring policies.
But at the end of the day there is no way around the tough and painful practical implications of prioritizing existence as an overriding moral norm over being moral in other respects. When important for existence, violating the rights of others should be accepted, with regret but with determination. Support or condemnation of various countries and their policies should be decided upon primarily in light of probable consequences for the existence of the Jewish people.
In short, the imperatives of existence should be given priority over other concerns — however important they may be — including liberal and humanitarian values, support for human rights and democratization.
This tragic but compelling conclusion is not easy to swallow, but it is essential for the future of the Jewish people. Once our existence is assured, including basic security for Israel, much can and should be sacrificed for tikkun olam. But given present and foreseeable realities, assuring existence must come first.
Yehezkel Dror, the founding president of the Jewish People Policy Planning Institute, is a professor emeritus of political science at the Hebrew University of Jerusalem. A recipient of the Israel Prize, he served as a member of the Winograd commission of inquiry into Israel’s war with Hezbollah in 2006.
mardi 27 mai 2008
Mr LOVE .... Reggie LOVE ....
... Mr. Love, 26, 6-foot-5, is about three inches taller than the tall candidate, fitter than the fit candidate (he can bench press more than 350 pounds) and cooler than the cool candidate ..... YES THEY CAN !!!!.....!!!!
cu Lissandru, 23 05 2008, 13 H, sotto u laggu d'Oriente e u Ritundu

laggu d'oriente, 2060 m
ritundu, 2622 m ...... 306 °, probablement le plus beau panorama des montagnes corses !!!
WAR AGAINST CO². Basic fossil fuel facts must be combined with basic climate facts toward actions to STOP FOSSIL FUEL EXTRACTION

original publication (pdf)
Dr James Hansen
Director
NASA Goddard Institute for Space Studies
2880 Broadway
New York, NY 10025 USA
B.A., Physics and Mathematics, 1963, University of Iowa
M.S., Astronomy, 1965, University of Iowa
Ph.D., Physics, 1967, University of Iowa
E-mail: James.E.Hansen@nasa.gov
Phone: (212) 678-5500
Curriculum Vitae
Publications
Research Interests:
As a college student in Iowa, I was attracted to science and research by James Van Allen's space science program in the physics and astronomy department. Since then, it only took me a decade or so to realize that the most exciting planetary research involves trying to understand the climate change on earth that will result from anthropogenic changes of the atmospheric composition.
One of my research interests is radiative transfer in planetary atmospheres, especially interpreting remote sounding of the earth's atmosphere and surface from satellites. Such data, appropriately analyzed, may provide one of our most effective ways to monitor and study global change on the earth. The hardest part is trying to influence the nature of the measurements obtained, so that the key information can be obtained.
I am also interested in the development and application of global numerical models for the purpose of understanding current climate trends and projecting humans' potential impacts on climate. The scientific excitement in comparing theory with data, and developing some understanding of global changes that are occurring, is what makes all the other stuff worth it.
*************************************************************************************
*************************************************************************************
*************************************************************************************
WE MUST BREAK OUR ADDICTION AND MOVE TOWARD ZERO FOSSIL FUEL EMISSION
« Un combat majeur se prépare - on peut l’appeler une guerre. D’un côté se trouvent les intérêts financiers à court terme de l’industrie pétrolière. De l’autre, les jeunes et les êtres qui hériteront de la planète. Le combat peut sembler inégal. La bataille peut débuter par des escarmouches au niveau local et régional, contre une centrale à charbon ou autre, mais elle doit s’étendre rapidement. Nous manquons de temps. » J. HANSEN, 10 04 08
When I was young, Yankee Stadium had 70,000 seats. It seldom sold out, and almost any kid could afford the cheap seats. Capacity was reduced to 57,000 when the stadium was remodeled in the 1970s. Most games sell out now, and prices have gone up.
The new stadium, opening next year, will reduce seating further, to 51,800. This intentional contraction is aimed at guaranteeing sellouts, increasing demand, allowing the owners, in pretty short order, to hike prices to double, triple, and more. The owners know that scarcity will fatten their wallets, even though it reduces the number of sales.
This is more than a bit distasteful, as it discriminates against the lower middle class. Nevertheless, it should be a great stadium and as long as the owner is footing the bill without public subsidies for the stadium itself, we may have little grounds for complaint.
The reason that I draw your attention to this practice is that fossil fuel moguls are intent on hoodwinking the entire planet with an analogous scheme.
The basic trick is this : fossil fuel reserves are overstated.
Government “energy information” departments parrot industry.
Partly because of this disinformation, the major efforts needed to develop energies “beyond fossil fuels” have not been made.
The reality of limited supply forces prices higher. Eventually, sales volume will begin to decline, but fossil fuel moguls will make more money than ever. They will continue to assert that there is plenty more to be found, aiming to keep the suckers (that’s us) on the hook. Indeed, they could find somewhat more in the deep ocean, under national parks, in polar regions, offshore, and in other environmentally sensitive areas. They don’t need much to keep the suckers paying higher and higher prices.
Oil “reserves” suddenly doubled when OPEC decided that production quotas would be proportional to official reserves. These higher reserves are, at least in part, phantom. Coal “reserves” are based on estimates made many decades ago. Closer study shows that extractable coal reserves are vastly overstated, which is consistent with present production difficulties and rising prices. The presumed “200 year” supply of coal in the United States is a myth, but it serves industry moguls well.
Conventional fossil fuel supplies are limited, even if we tear up the Earth to extract every last drop of oil and shard of coal. Tearing up the Earth to get at those last drops, even though Exxon/Mobil proudly advertises that they are drilling to the depths of the ocean and going to the most extreme pristine environments, is, for us, as insane as the smoker who trudged four miles through a raging storm to buy a pack of Camels to feed his nicotine addiction.
It would be possible to find more fossil fuels, and extend our addiction and pollution of the environment, should we be so foolish as to take the path of extracting unconventional fossil fuels such as tar shale and tar sands on a large scale. That choice cannot be left to the discretion of industry moguls. The planet does not belong to them.
Basic fossil fuel facts (about reserves) must be combined with basic climate facts described in the paper “Target Atmospheric CO2 : Where Should Humanity Aim ?”. That paper has been submitted to Science and is available in arXiv, the permanent archive for physics preprints.
The main paper is at : http://arxiv.org/abs/0804.1126 and the Supporting Material is at : http://arxiv.org/abs/0804.1135
Our conclusion is that, if humanity wishes to preserve a planet similar to the one on which civilization developed and to which life on Earth is adapted, CO2 must be reduced from its present 385 ppm to, at most, 350 ppm.
We find that peak CO2 can be kept to 425 ppm, even with generous (large) estimates for oil and gas reserves, if coal use is phased out by 2030 (except where CO2 is captured and sequestered) and unconventional fossil fuels are not tapped substantially. Peak CO2 can be kept close to 400 ppm, if actual reserves are closer to those estimated by “peakists” (people who believe that we are already at peak global oil production, having extracted about half of readily extractable oil resources).
This lower 400 ppm peak can be ensured (assuming phase-out of coal emissions by 2030) if a practical limit on reserves is achieved by means of actions that prevent fossil fuel extraction from public lands, off-shore regions under government control, environmentally pristine regions, and extreme environments.
The concerned public can influence this matter and it is important to do so now - time is short, the industry voice is strong, and climate effects have not yet become so obvious to the public as to overwhelm the disinformation of industry moguls.
A near-term moratorium on coal-fired power plants and constraints on oil extraction in extreme environments are important, because once CO2 is emitted to the air much of it will remain there for centuries. Our paper describes ways in which improved agricultural and forestry practices, mostly reforestation, could draw down atmospheric CO2 about 50 ppm by the end of the century. But a greater drawdown by such more-or-less natural methods does not seem practical, making a long-term overshoot of the 350 ppm level, with potentially disastrous consequences, a near certainty if we stay on a business-as-usual course for several more years.
If we choose a different path, which permits the possibility of getting back to 350 ppm CO2 or lower this century, we will minimize the chance of passing tipping points that spiral out of control, such as disintegration of ice sheets, rapid sea level rise, and extermination of countless species. At the same time we will solve problems that had begun to seem intractable, such as acidification of the ocean with consequent loss of coral reefs.
A fundamental point is that, in any event, we must move beyond fossil fuels reasonably soon. The underlying reason is that a large fraction of CO2 emissions remains in the air for many centuries.
Thus the upshot : we must move to zero fossil fuel emissions.
This is a fact, a certainty, a lead pipe cinch. So why not do it a bit sooner, in time to avert climate crises ? At the same time, we halt other pollution that comes from fossil fuels, including mercury pollution, conventional air pollution, problems stemming from mountain-top removal, etc.
Breaking an addiction is not easy. But we may now be at a point analogous to that of the smoker who told me about trudging four miles through rain to get a pack of Camels - when he got back to his motel he threw the pack of Camels away and never smoked again.
Fossil fuel addiction is much more difficult — an epiphany to one person cannot solve the problem. This problem requires global cooperation. We must be on a new path within the next several years, or, our paper shows, it becomes implausible to reduce CO2 below the dangerous level this century. Developed countries, as the cause of most of the excess CO2 in the air today, must lead in the steps needed to develop clean energy and halt CO2 emissions. Yet it is hardly a sacrifice : ‘green’ jobs will be an economic stimulus and a boon to worker well-being.
A major fight is brewing - it may be called war. On the one side, we find the short-term financial interests of the fossil fuel industry. On the other side : young people and other beings who will inherit the planet. It seems to be an uneven fight. The fossil fuel industry is launching a disinformation campaign and they have powerful influence in capitals around the world.
Young people seem pretty puny in comparison to industry moguls. Animals are not much help (don’t talk, don’t vote). The battle may start with local and regional skirmishes, one coal plant or other issue at a time, but it will need to build rapidly - we are running out of time.
P.S. : Do not fall for the moguls’ dirtiest trick - ‘green’ messages spewed to the public.
That is propaganda, intended to leave the impression they are moving in the right direction.
Meanwhile they hire scientific has-beens to dispute evidence and confuse the public.
How will you be able to tell if they ever “get it” ? When they begin to invest massively in renewable energies, when they become truly energy companies aimed toward zero-carbon emissions.
jeudi 22 mai 2008
a rich design toolkit for mixing, separating, and analyzing cells and functional beads on-chip
Published online on May 21, 2008
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0712398105
BIOPHYSICS / ENGINEERING
Hydrodynamic metamaterials: Microfabricated arrays to steer, refract, and focus streams of biomaterials
Keith J. Morton*, Kevin Loutherback*, David W. Inglis*, Ophelia K. Tsui, James C. Sturm*, Stephen Y. Chou*, and Robert H. Austin,
Departments of *Electrical Engineering and Physics, Princeton University, Princeton, NJ 08544-1014; and Department of Physics, Boston University, Cambridge, MA 02215
Contributed by Robert H. Austin, February 21, 2008 (sent for review December 31, 2007)
Abstract
We show that it is possible to direct particles entrained in a fluid along trajectories much like rays of light in classical optics.
A microstructured, asymmetric post array forms the core hydrodynamic element and is used as a building block to construct microfluidic metamaterials and to demonstrate refractive, focusing, and dispersive pathways for flowing beads and cells.
The core element is based on the concept of deterministic lateral displacement where particles choose different paths through the asymmetric array based on their size:
Particles larger than a critical size are displaced laterally at each row by a post and move along the asymmetric axis at an angle to the flow, while smaller particles move along streamline paths.
We create compound elements with complex particle handling modes by tiling this core element using multiple transformation operations; we show that particle trajectories can be bent at an interface between two elements and that particles can be focused into hydrodynamic jets by using a single inlet port.
Although particles propagate through these elements in a way that strongly resembles light rays propagating through optical elements, there are unique differences in the paths of our particles as compared with photons.
The unusual aspects of these modular, microfluidic metamaterials form a rich design toolkit for mixing, separating, and analyzing cells and functional beads on-chip.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0712398105
BIOPHYSICS / ENGINEERING
Hydrodynamic metamaterials: Microfabricated arrays to steer, refract, and focus streams of biomaterials
Keith J. Morton*, Kevin Loutherback*, David W. Inglis*, Ophelia K. Tsui, James C. Sturm*, Stephen Y. Chou*, and Robert H. Austin,
Departments of *Electrical Engineering and Physics, Princeton University, Princeton, NJ 08544-1014; and Department of Physics, Boston University, Cambridge, MA 02215
Contributed by Robert H. Austin, February 21, 2008 (sent for review December 31, 2007)
Abstract
We show that it is possible to direct particles entrained in a fluid along trajectories much like rays of light in classical optics.
A microstructured, asymmetric post array forms the core hydrodynamic element and is used as a building block to construct microfluidic metamaterials and to demonstrate refractive, focusing, and dispersive pathways for flowing beads and cells.
The core element is based on the concept of deterministic lateral displacement where particles choose different paths through the asymmetric array based on their size:
Particles larger than a critical size are displaced laterally at each row by a post and move along the asymmetric axis at an angle to the flow, while smaller particles move along streamline paths.
We create compound elements with complex particle handling modes by tiling this core element using multiple transformation operations; we show that particle trajectories can be bent at an interface between two elements and that particles can be focused into hydrodynamic jets by using a single inlet port.
Although particles propagate through these elements in a way that strongly resembles light rays propagating through optical elements, there are unique differences in the paths of our particles as compared with photons.
The unusual aspects of these modular, microfluidic metamaterials form a rich design toolkit for mixing, separating, and analyzing cells and functional beads on-chip.
a message to Senator Hillary CLINTON
Madam,
Most Respected Senator Clinton,
Your honor and reputation are now at stake.
Could you please,
1/ take a look at those videos :
http://edition.cnn.com/video/?/video/politics/2008/05/21/ec.seg.gergen.cnn
http://www.youtube.com/watch?v=c-q4MDQ0cDI&feature=user
http://www.youtube.com/watch?v=yL3mTBe-E-o
2/ read this paper :
"Hillary Clinton’s suicidal gamble with race poison"
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/andrew_sullivan/article3907239.ece
Please, Madam, do not let them spoil the "Clinton's Era" image with such disturbing issues .... do not accept such support, reject racism .....
http://edition.cnn.com/video/?/video/politics/2008/05/21/ec.seg.gergen.cnn
Do it. Before it's too late. Please.
I stay, Madam, as your most respectful supporter.
Please, if you agree with this message and are worried about this issue, copy, paste and send it to Senator Hillary Clinton :
http://www.hillaryclinton.com/HELP/CONTACT/
and / or
http://www.senate.gov/~clinton/contact/webform.cfm
Most Respected Senator Clinton,
Your honor and reputation are now at stake.
Could you please,
1/ take a look at those videos :
http://edition.cnn.com/video/?/video/politics/2008/05/21/ec.seg.gergen.cnn
http://www.youtube.com/watch?v=c-q4MDQ0cDI&feature=user
http://www.youtube.com/watch?v=yL3mTBe-E-o
2/ read this paper :
"Hillary Clinton’s suicidal gamble with race poison"
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/andrew_sullivan/article3907239.ece
Please, Madam, do not let them spoil the "Clinton's Era" image with such disturbing issues .... do not accept such support, reject racism .....
http://edition.cnn.com/video/?/video/politics/2008/05/21/ec.seg.gergen.cnn
Do it. Before it's too late. Please.
I stay, Madam, as your most respectful supporter.
Please, if you agree with this message and are worried about this issue, copy, paste and send it to Senator Hillary Clinton :
http://www.hillaryclinton.com/HELP/CONTACT/
and / or
http://www.senate.gov/~clinton/contact/webform.cfm
mercredi 21 mai 2008
in vitro profiling of biologic activity
Perturbational profiling of nanomaterial biologic activity
Stanley Y. Shaw
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0802878105
Our understanding of the biologic effects (including toxicity) of nanomaterials is incomplete.
In vivo animal studies remain the gold standard; however, widespread testing remains impractical, and the development of in vitro assays that correlate with in vivo activity has proven challenging.
Here, we demonstrate the feasibility of analyzing in vitro nanomaterial activity in a generalizable, systematic fashion.
We assessed nanoparticle effects in a multidimensional manner, using multiple cell types and multiple assays that reflect different aspects of cellular physiology.
Hierarchical clustering of these data identifies nanomaterials with similar patterns of biologic activity across a broad sampling of cellular contexts, as opposed to extrapolating from results of a single in vitro assay.
We show that this approach yields robust and detailed structure–activity relationships.
Furthermore, a subset of nanoparticles were tested in mice, and nanoparticles with similar activity profiles in vitro exert similar effects on monocyte number in vivo.
These data suggest a strategy of multidimensional characterization of nanomaterials in vitro that can inform the design of novel nanomaterials and guide studies of in vivo activity.
Stanley Y. Shaw
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0802878105
Our understanding of the biologic effects (including toxicity) of nanomaterials is incomplete.
In vivo animal studies remain the gold standard; however, widespread testing remains impractical, and the development of in vitro assays that correlate with in vivo activity has proven challenging.
Here, we demonstrate the feasibility of analyzing in vitro nanomaterial activity in a generalizable, systematic fashion.
We assessed nanoparticle effects in a multidimensional manner, using multiple cell types and multiple assays that reflect different aspects of cellular physiology.
Hierarchical clustering of these data identifies nanomaterials with similar patterns of biologic activity across a broad sampling of cellular contexts, as opposed to extrapolating from results of a single in vitro assay.
We show that this approach yields robust and detailed structure–activity relationships.
Furthermore, a subset of nanoparticles were tested in mice, and nanoparticles with similar activity profiles in vitro exert similar effects on monocyte number in vivo.
These data suggest a strategy of multidimensional characterization of nanomaterials in vitro that can inform the design of novel nanomaterials and guide studies of in vivo activity.
mardi 20 mai 2008
lundi 19 mai 2008
dimanche 18 mai 2008
vendredi 16 mai 2008
jeudi 15 mai 2008
Tiny Bodies in a Morgue, and Grief in China

Parents at a makeshift morgue on Wednesday in Juyuan, China, held the body of their child, killed in Monday’s earthquake.
nytimes.com
The bodies are everywhere. Some are zipped inside white vinyl bags and strewn on the floor. Others have been covered in a favorite blanket or dressed in new clothes. There are so many bodies that undertakers want to cremate them in groups. They are all children.
Our grief is incomparable,” said Li Ping, 39, eyes rimmed red, as he and his wife slowly, carefully pulled a pair of pink pajamas over the bruised, naked body of their 8-year-old daughter, Ke. “We got married late, and had a child late. She is our only child.”
The earthquake that struck Sichuan Province on Monday has so far claimed more than 19,000 lives across China, and thousands more people remain missing or trapped beneath rubble. But the awful scene at this local morgue is a sad reminder that too many of the dead are children .....
These children symbolized the earthquake’s seemingly indiscriminate cruelty. Several schools in nearby Dujiangyan collapsed while classes were under way.
The morgue is an hour outside Dujiangyan on an isolated rural road, yet the parking lot was filled at 1:50 a.m. on Thursday. Parents and other family members clustered around the bodies of their children. Some burned fake money to bring their lost child good fortune in the afterlife. In one room, 25 small bodies were scattered on the floor. Some children had already been taken away; an empty white body bag lay near a sneaker and a filthy pair of boy’s trousers. Some families had placed flowers or incense inside empty water bottles as makeshift memorials.
“There are more in there,” said a man, pointing to a rear door. He walked outside to a walkway and paused. Scores of bodies, covered with sheets, were lined in two long rows on the concrete floor. Others were placed in an adjacent room. Parents sobbed or sat silently beside bodies.
“They are all students,” said the man in the blue shirt. “Look,” he said pointing to a red and white jacket folded beside one body. “That is the school uniform.” He pointed to a Mickey Mouse backpack. “There is a book bag.”
The two rows of bodies came to an open door that led to the large steel furnaces used for cremation. In China, the dead are almost always cremated fairly soon after death. Usually, there is enough time for funeral ceremonies and rituals, but parents said that officials were worried about cremating so many bodies before they started to decompose. So some parents have been asked if their children can be cremated with dead friends to save time.
At the morgue on Wednesday, parents walked through rooms lined with bodies on the floor, lifting sheets in the unwanted search to identify a lost child. Cai Changrong, 37, held an urn containing the ashes of his cremated 9-year-old daughter. His wife, Hu Xiu, could not stop wailing.
“We didn’t find any bruises or injuries on her body,” said Ms. Hu, the mother. “But she lost all her nails. She was trying to scratch her way out. I think my daughter suffocated to death.”
Mr. Li, the father dressing his dead daughter, also said he believed that the school was poorly built. He arrived at the school minutes after the quake and spent the next four hours searching for his daughter. His forearms were bruised and his fingernails were split and bloodied from digging.
He proudly handed over his cellphone and showed a picture of his daughter, Ke, taken last week. But Thursday morning, he and his wife were preparing for her cremation. They struggled to slip her into the pink pajamas and then dressed her in a gray sweatshirt and pants. Her mother placed a white silk mourning cloth under her clotted black hair.
Mr. Li said he lost his job in 1997 and had been living on a meager welfare payment. He said the school was filled with children from poor families. “My daughter was a very good student,” he said. “She was a quiet girl, and she liked to paint. We’re putting her in these clothes because she loved them.”
He said he was angry and sad. He said his daughter’s body was still warm when he found her at the morgue on Wednesday. He wondered how long she lived beneath the rubble. And then he turned away, leaning down slightly, and whispered in her ear.
“My little daughter,” he said quietly. “You used to dress yourself. Now I have to do it for you.”
JUYUAN, China.
JIM YARDLEY, The New-York Times.
Published: May 15, 2008.
Important parallels with mechanisms of tumor vascularization.
Four-dimensional analysis of vascularization during primary development of an organ, the gonad.
Douglas Coveney ...... Department of Cell Biology, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710
Time-lapse microscopy has advanced our understanding of yolk sac and early embryonic vascularization. However, it has been difficult to assess endothelial interactions during epithelial morphogenesis of internal organs.
To address this issue we have developed the first time-lapse system to study vascularization of a mammalian organ in four dimensions.
We show that vascularization of XX and XY gonads is a highly dynamic, sexually dimorphic process.
The XX gonad recruits vasculature by a typical angiogenic process.
In contrast, the XY gonad recruits and patterns vasculature by a novel remodeling mechanism beginning with breakdown of an existing mesonephric vessel.
Subsequently, in XY organs individual endothelial cells migrate and reaggregate in the coelomic domain to form the major testicular artery.
Migrating endothelial cells respect domain boundaries well before they are morphologically evident, subdividing the gonad into 10 avascular regions where testis cords form.
This model of vascular development in an internal organ has a direct impact on the current dogma of vascular integration during organ development and presents important parallels with mechanisms of tumor vascularization.
Published online on May 14, 2008, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0707674105
Douglas Coveney ...... Department of Cell Biology, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710
Time-lapse microscopy has advanced our understanding of yolk sac and early embryonic vascularization. However, it has been difficult to assess endothelial interactions during epithelial morphogenesis of internal organs.
To address this issue we have developed the first time-lapse system to study vascularization of a mammalian organ in four dimensions.
We show that vascularization of XX and XY gonads is a highly dynamic, sexually dimorphic process.
The XX gonad recruits vasculature by a typical angiogenic process.
In contrast, the XY gonad recruits and patterns vasculature by a novel remodeling mechanism beginning with breakdown of an existing mesonephric vessel.
Subsequently, in XY organs individual endothelial cells migrate and reaggregate in the coelomic domain to form the major testicular artery.
Migrating endothelial cells respect domain boundaries well before they are morphologically evident, subdividing the gonad into 10 avascular regions where testis cords form.
This model of vascular development in an internal organ has a direct impact on the current dogma of vascular integration during organ development and presents important parallels with mechanisms of tumor vascularization.
Published online on May 14, 2008, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0707674105
Les bisphénols A peuvent être dangereux pour la santé : des produits en plastiques bientôt interdits au Canada.
Des produits de plastique dans la mire de Santé Canada
Ariane Lacoursière
La Presse
Dès le mois de mai, ces molécules qui se retrouvent aussi bien dans les canettes de boissons gazeuses que sur les revêtements de CD pourraient être qualifiées de «dangereuses» par le gouvernement. Des entreprises ont déjà commencé à retirer de leurs tablettes les produits contenant des bisphénols A.
Biberons, bouteilles, canettes, casques de hockey, scellants dentaires... Plusieurs produits de la vie courante contiennent des bisphénols A (BPA). «Ces molécules sont utilisées pour faire du polycarbonate, un plastique dur et transparent», explique Pierre Ayotte, de l'Institut national de santé publique du Québec.
En février dernier, les BPA ont fait les manchettes au Canada. Des groupes de consommateurs s'étaient inquiétés du fait que plus de 90% des biberons en plastique vendus au pays sont composés de cette substance.
C'est l'influence hormonale des BPA qui soulève la controverse. Les bisphénols A agissent un peu comme des oestrogènes. Chez l'humain, ils peuvent entraîner des débalancements hormonaux. On les soupçonne aussi de causer les cancers de la prostate et du sein.
«Chaque fois qu'on utilise un biberon ou une bouteille qui contient des bisphénols A, une petite quantité se libère», explique M. Ayotte. Il est toutefois difficile de savoir si la dose libérée est suffisante pour avoir des effets néfastes sur la santé. Les études sont contradictoires sur le sujet.
Malgré tout, Santé Canada classera les bisphénols A et une quinzaine d'autres produits dans les «substances dangereuses» dès la mi-mai, selon le quotidien Toronto Star. Santé Canada refuse pour l'instant de le confirmer. «Le ministre (de la Santé) a dit que quand il aura une annonce à faire, il la fera», s'est contenté de dire un porte-parole de l'organisme.
Si le gouvernement allait de l'avant, le Canada deviendrait le premier pays au monde à qualifier les BPA de dangereux.
Il ne fera probablement pas bande à part très longtemps. Mardi, le National Toxicology Program des États-Unis a annoncé avoir réalisé une étude prouvant que les bisphénols A peuvent être dangereux pour la santé.
Même si le Canada n'a pas encore présenté sa position, certaines compagnies ont déjà commencé à réagir. Mardi, le Groupe Forzani, propriétaire de 64 Sports Experts au Québec, a entrepris de retirer toutes les bouteilles d'eau contenant des BPA des tablettes de ses magasins.
La Compagnie de la Baie d'Hudson a aussi annoncé le retrait de tous les produits pour bébés contenant des BPA.
Les chaînes Mountain Equipment Co-op et Lululemon Athletica vendent depuis quelques semaines des bouteilles d'eau sans bisphénol A.
Quelle bouteille choisir?
Seuls les plastiques durs et transparents, comme celui des bouteilles de sport, contiennent des bisphénols A.
Les plastiques mous, comme ceux des bouteilles d'eau Naya et d'autres marques, n'en contiennent pas.
Pour savoir si un plastique est un polycarbonate (contenant des BPA), on peut regarder le sceau de recyclage.
Les polycarbonates sont représentés par le chiffre 7 dans le petit triangle fléché, accompagné des lettres PC.
Ariane Lacoursière
La Presse
Dès le mois de mai, ces molécules qui se retrouvent aussi bien dans les canettes de boissons gazeuses que sur les revêtements de CD pourraient être qualifiées de «dangereuses» par le gouvernement. Des entreprises ont déjà commencé à retirer de leurs tablettes les produits contenant des bisphénols A.
Biberons, bouteilles, canettes, casques de hockey, scellants dentaires... Plusieurs produits de la vie courante contiennent des bisphénols A (BPA). «Ces molécules sont utilisées pour faire du polycarbonate, un plastique dur et transparent», explique Pierre Ayotte, de l'Institut national de santé publique du Québec.
En février dernier, les BPA ont fait les manchettes au Canada. Des groupes de consommateurs s'étaient inquiétés du fait que plus de 90% des biberons en plastique vendus au pays sont composés de cette substance.
C'est l'influence hormonale des BPA qui soulève la controverse. Les bisphénols A agissent un peu comme des oestrogènes. Chez l'humain, ils peuvent entraîner des débalancements hormonaux. On les soupçonne aussi de causer les cancers de la prostate et du sein.
«Chaque fois qu'on utilise un biberon ou une bouteille qui contient des bisphénols A, une petite quantité se libère», explique M. Ayotte. Il est toutefois difficile de savoir si la dose libérée est suffisante pour avoir des effets néfastes sur la santé. Les études sont contradictoires sur le sujet.
Malgré tout, Santé Canada classera les bisphénols A et une quinzaine d'autres produits dans les «substances dangereuses» dès la mi-mai, selon le quotidien Toronto Star. Santé Canada refuse pour l'instant de le confirmer. «Le ministre (de la Santé) a dit que quand il aura une annonce à faire, il la fera», s'est contenté de dire un porte-parole de l'organisme.
Si le gouvernement allait de l'avant, le Canada deviendrait le premier pays au monde à qualifier les BPA de dangereux.
Il ne fera probablement pas bande à part très longtemps. Mardi, le National Toxicology Program des États-Unis a annoncé avoir réalisé une étude prouvant que les bisphénols A peuvent être dangereux pour la santé.
Même si le Canada n'a pas encore présenté sa position, certaines compagnies ont déjà commencé à réagir. Mardi, le Groupe Forzani, propriétaire de 64 Sports Experts au Québec, a entrepris de retirer toutes les bouteilles d'eau contenant des BPA des tablettes de ses magasins.
La Compagnie de la Baie d'Hudson a aussi annoncé le retrait de tous les produits pour bébés contenant des BPA.
Les chaînes Mountain Equipment Co-op et Lululemon Athletica vendent depuis quelques semaines des bouteilles d'eau sans bisphénol A.
Quelle bouteille choisir?
Seuls les plastiques durs et transparents, comme celui des bouteilles de sport, contiennent des bisphénols A.
Les plastiques mous, comme ceux des bouteilles d'eau Naya et d'autres marques, n'en contiennent pas.
Pour savoir si un plastique est un polycarbonate (contenant des BPA), on peut regarder le sceau de recyclage.
Les polycarbonates sont représentés par le chiffre 7 dans le petit triangle fléché, accompagné des lettres PC.
mercredi 14 mai 2008
Durée du travail en France : un mensonge d'Etat
"La France ne travaille pas assez ! Il n'y a qu'un moyen de relancer la croissance et d'augmenter le pouvoir d'achat : travailler plus ! Par rapport à nos voisins, nous sommes le pays qui travaille le moins, il faut que ça change !" Voilà le message dont nous rebat les oreilles avec un bel ensemble la majorité présidentielle, à commencer par le Président Sarkozy lui-même. Or c'est faux, tout simplement et grossièrement faux.
Merci à Léon Mercadet, journaliste à La matinale de Canal +, d'avoir rétabli les faits dans sa chronique d'hier, titrée La France bosse fort !
Pour remettre les choses à leur place, il suffit de consulter les chiffres 2006 d'Eurostat, le très officiel Office statistique des Communautés européennes, que la chaîne à péage présente on ne peut plus clairement, reprenant un tableau paru dans l'excellente revue Alternatives économiques :
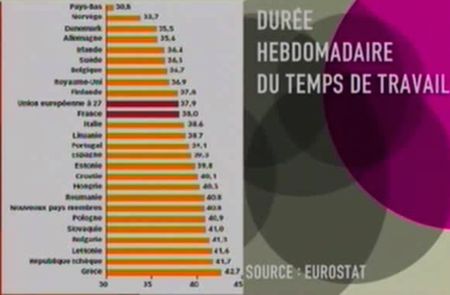
Dans l'ordre croissant en nombre d'heures travaillées par semaine, on trouve d'abord les Pays-Bas puis la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède, la Belgique, le Royaume-Uni et la Finlande.
Vient ensuite la moyenne européenne, à 37,9 heures.
Le premier pays à travailler plus que ladite moyenne, de justesse (38h tout rond) est la France.
Viennent derrière l'Italie, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne, l'Estonie, la Croatie, la Slovénie...
Les plus gros travailleurs sont enfin les Bulgares, Lettons, Tchèques et Grecs (42,7 heures).
Le tableau ci-dessus concerne la durée hebdomadaire mais on observe la même chose en se basant sur la durée annuelle, qui prend en compte vacances et jours fériés : elle est en France de 1545 heures, contre 1445 en Allemagne, 1499 au Danemark, les Pays-Bas étant le pays où l'on travaille le moins avec 1340 heures.
"Il y a un truc très très frappant, observe Léon Mercadet, c'est que les pays où l'on travaille le moins sont les plus avancés, les plus performants économiquement et socialement." "Ca alors !", s'exclame le présentateur de l'émission, Bruce Toussaint. "A l'inverse, poursuit son chroniqueur, si on va en bas de classement, on s'aperçoit que les cancres sont (...) ceux dont le PIB par habitant est le plus faible.
Tout se passe comme si plus on est un pays moderne, plus on est un pays économiquement performant, moins on travaille !
Allez savoir pourquoi, mais moins l'on travaille et plus le PIB par habitant est élevé, c'est comme ça que ça se passe en Europe.
Alors quand les ministres et les porte-paroles du gouvernement nous répètent que nous ne travaillons pas assez, je me pose la question : est-ce ignorance ou est-ce mensonge délibéré ?
En tout cas, c'est de l'idéologie, ce n'est pas des faits.
J'ai quand même l'impression qu'on nous répète ça dans l'espoir qu'un mensonge cent fois répété devienne une vérité. Alors dans quel but cette distorsion des faits ? (...)
Il y a une réponse évidente: c'est pour supprimer les 35h. Pourquoi supprimer les 35h ? Parce que c'est la durée légale. Ca veut dire quoi ? C'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Donc les Français travaillent déjà plus de 35h - on est à 38 - mais si on fait sauter les 35h, on n'a plus besoin de payer entre 35 et 38 au tarif des heures supplémentaires."
C'était hier matin en clair, entre 7h 10 et 7h 20 : un grand moment de vérité à la télévision, qui laissait éclater en plein jour toute l'imposture de nos gouvernants.
Mais rassurez-vous, rien ne changera et cette droite menteuse continuera inlassablement à ressasser l'ineptie que les Français ne travailleraient pas assez.
Quelqu'un dans l'opposition pour lui balancer les chiffres à la face, comme Léon Mercadet ce matin-là sur Canal + ?
Merci à Léon Mercadet, journaliste à La matinale de Canal +, d'avoir rétabli les faits dans sa chronique d'hier, titrée La France bosse fort !
Pour remettre les choses à leur place, il suffit de consulter les chiffres 2006 d'Eurostat, le très officiel Office statistique des Communautés européennes, que la chaîne à péage présente on ne peut plus clairement, reprenant un tableau paru dans l'excellente revue Alternatives économiques :
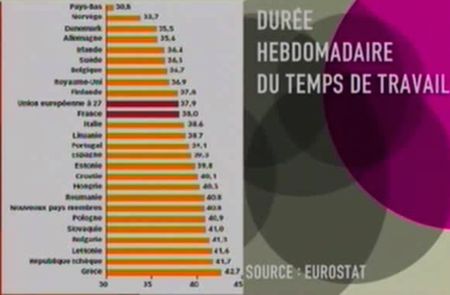
Dans l'ordre croissant en nombre d'heures travaillées par semaine, on trouve d'abord les Pays-Bas puis la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède, la Belgique, le Royaume-Uni et la Finlande.
Vient ensuite la moyenne européenne, à 37,9 heures.
Le premier pays à travailler plus que ladite moyenne, de justesse (38h tout rond) est la France.
Viennent derrière l'Italie, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne, l'Estonie, la Croatie, la Slovénie...
Les plus gros travailleurs sont enfin les Bulgares, Lettons, Tchèques et Grecs (42,7 heures).
Le tableau ci-dessus concerne la durée hebdomadaire mais on observe la même chose en se basant sur la durée annuelle, qui prend en compte vacances et jours fériés : elle est en France de 1545 heures, contre 1445 en Allemagne, 1499 au Danemark, les Pays-Bas étant le pays où l'on travaille le moins avec 1340 heures.
"Il y a un truc très très frappant, observe Léon Mercadet, c'est que les pays où l'on travaille le moins sont les plus avancés, les plus performants économiquement et socialement." "Ca alors !", s'exclame le présentateur de l'émission, Bruce Toussaint. "A l'inverse, poursuit son chroniqueur, si on va en bas de classement, on s'aperçoit que les cancres sont (...) ceux dont le PIB par habitant est le plus faible.
Tout se passe comme si plus on est un pays moderne, plus on est un pays économiquement performant, moins on travaille !
Allez savoir pourquoi, mais moins l'on travaille et plus le PIB par habitant est élevé, c'est comme ça que ça se passe en Europe.
Alors quand les ministres et les porte-paroles du gouvernement nous répètent que nous ne travaillons pas assez, je me pose la question : est-ce ignorance ou est-ce mensonge délibéré ?
En tout cas, c'est de l'idéologie, ce n'est pas des faits.
J'ai quand même l'impression qu'on nous répète ça dans l'espoir qu'un mensonge cent fois répété devienne une vérité. Alors dans quel but cette distorsion des faits ? (...)
Il y a une réponse évidente: c'est pour supprimer les 35h. Pourquoi supprimer les 35h ? Parce que c'est la durée légale. Ca veut dire quoi ? C'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Donc les Français travaillent déjà plus de 35h - on est à 38 - mais si on fait sauter les 35h, on n'a plus besoin de payer entre 35 et 38 au tarif des heures supplémentaires."
C'était hier matin en clair, entre 7h 10 et 7h 20 : un grand moment de vérité à la télévision, qui laissait éclater en plein jour toute l'imposture de nos gouvernants.
Mais rassurez-vous, rien ne changera et cette droite menteuse continuera inlassablement à ressasser l'ineptie que les Français ne travailleraient pas assez.
Quelqu'un dans l'opposition pour lui balancer les chiffres à la face, comme Léon Mercadet ce matin-là sur Canal + ?
COMBIEN VAUT UN ENFANT ? ou les « Miles » et une façon de récompenser ses fonctionnaires
FIDH (*), le jeudi 24 avril 2008, Gaël Grilhot.
Les policiers qui raccompagnent les Sans-Papiers expulsés ont droit à des Miles, nous dit le « Canard Enchainé » de cette semaine.
Sont-ils doublés lorsqu'il s'agit d'une famille ?
Combien vaut un enfant : 500 miles, 1000 miles ?
A quand
- les chèques cadeaux pour les prises en flag dans les grands magasins,
- les bons essence pour les patrouilles en voiture,
- ou les réducs en pharmacie pour chaque bavure et passage à tabac.
Au fait, il y a des bonnes promos en ce moment sur les dictionnaires et encyclopédies, très pratique pour les gardes à vue...
Trève d’ironie facile, les reconduites à la frontière enfreignent déjà trop souvent les limites du supportable pour que l’on y rajoute l’indécence de ces « primes » privées accordées à des fonctionnaires pour le coup très zélés.
Au fait, s'agit-il de récompense, ou de compensation au vu du "sale boulot" qu'on leur fait faire ?
* FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
Les policiers qui raccompagnent les Sans-Papiers expulsés ont droit à des Miles, nous dit le « Canard Enchainé » de cette semaine.
Sont-ils doublés lorsqu'il s'agit d'une famille ?
Combien vaut un enfant : 500 miles, 1000 miles ?
A quand
- les chèques cadeaux pour les prises en flag dans les grands magasins,
- les bons essence pour les patrouilles en voiture,
- ou les réducs en pharmacie pour chaque bavure et passage à tabac.
Au fait, il y a des bonnes promos en ce moment sur les dictionnaires et encyclopédies, très pratique pour les gardes à vue...
Trève d’ironie facile, les reconduites à la frontière enfreignent déjà trop souvent les limites du supportable pour que l’on y rajoute l’indécence de ces « primes » privées accordées à des fonctionnaires pour le coup très zélés.
Au fait, s'agit-il de récompense, ou de compensation au vu du "sale boulot" qu'on leur fait faire ?
* FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
mardi 13 mai 2008
Prof. Dr. Winfried Scharlau : "A preliminary essay on Grothendieck´s philosophical meditation "Les Mutants"
Prof. Dr. Winfried Scharlau, math.uni-muenster.de
18.07.2005
Summary and Introduction
The following text is a preliminary essay on Grothendieck´s philosophical meditation Les Mutants. It may be considered as part of a biography of Grothendieck (yet to be written).
In 1987 Grothendieck wrote, in form of a dairy, his meditation La Clef des Songes. In the process of writing, he very soon began to add comments to the text: Thus the Notes pour la Clef des Songes originated. Having finished La Clef des Songes, Grothendieck continued writing Notes, but an essentially independent meditation developed: Les Mutants. “Mutants” are humans who are ahead of their time, who are precursors of a coming “New Age”. They are distinguished by spiritual maturity, internal freedom, and insight in the nature of humanity. They personify the “man of tomorrow”. Grothendieck´s list of mutants contains 18 names; it is given in section 1 of this essay.
Grothendieck discusses at some length life, work, thinking, and achievements of these persons. In particular, he investigates their relation to ten central themes which include sex, war, science, education, and spirituality. The complete list with some explanations is given in section 5.
To read Les Mutants is difficult and heavy, but in some sense pleasant. Contrary to Recoltes et Semailles, Grothendieck talks about people that he clearly admires and that he considers models of humanity and spirituality. Therefore a positive undertone is dominant. The main objective of this essay is to show that Grothendieck wrote philosophical texts of a different nature than Recoltes and Semailles and La Clef des Songes. In Les Mutants we do not find the aggressiveness and the bitterness of Recoltes et Semailles and not the self-centredness of La Clef. We meet a Grothendieck in search of men´s destination.
It may be added that the impetus of writing Les Mutants and also the latter parts of La Clef des Songes resulted to a large extent from reading the books of Marcel Légaut, a Christian thinker. One of the mutants is Grothendieck´s lifelong friend Félix Carrasquer, a Spanish anarchist and school reformer. The relevant sections can be read as an “hommage for a friend”.
I thank XY, AB, and CD for valuable information, without which this work would not have been possible. I would like to stress that all translations from the original French text are preliminary.
Winfried Scharlau
Die Mutanten – Les Mutants –
eine Meditation von Alexander Grothendieck
1. Einführung
Von etwa Mai bis September 1987 schrieb Grothendieck die Meditation La Clef des Songes, in der er über seine Beschäftigung mit seinen Träumen (und vieles mehr, zum Beispiel die Biographie seiner Eltern und seine eigene) berichtet. Wie es auch sonst seine Arbeitsweise ist, beginnt er bald damit, zu diesem Text Ergänzungen zu notieren, und so entsteht eine weitere Meditation Notes pour la Clef des Songes, geschrieben zwischen Juni 1987 und April 1988 in Les Aumettes in der Nähe von Carpentras. Diese Notes bestehen aus zwei fast gänzlich unabhängigen Teilen: Bei den ersten 57 Abschnitten handelt es sich tatsächlich weitgehend um notes, um Ergänzungen zu dem eigentlichen Text. Die folgenden Abschnitte, geschrieben ab dem 18.9.1987, stellen jedoch eine eigenständige reflexion dar, der er auch einen eigenen Titel gibt: Les Mutants.
Der gesamte Text Notes pour la Clef des Songes umfasst 691 Seiten (ohne Inhaltsverzeichnisse) ; davon entfallen 515 Seiten auf den zweiten Teil. Er wurde vermutlich von einer versierten Schreibkraft, die Grothendieck für diese Arbeit angestellt hatte, mit der Maschine geschrieben. Überklebungen von kleineren Textstellen, Korrekturen mit Korrekturlack und kleine handschriftliche Korrekturen wurden von Grothendieck selbst mit großer Sorgfalt ausgeführt. Man kann das Typoskript als fast druckfertig (oder fertig für fotomechanische Reproduktion) bezeichnen. Es war ohne Zweifel ursprünglich zur Veröffentlichung bestimmt. Es ist nicht gebunden, sondern befindet sich auf losen Blättern in Archivschachteln, wie sie Grothendieck auch für seine anderen Manuskripte hat anfertigen lassen. Es ist gegenwärtig im Besitz (und vermutlich auch im Eigentum) von XY. Meines Wissens existiert nur eine einzige Kopie des Originals.
Worum geht es nun in diesem Text mit dem seltsamen Titel, der auch im Französischen eher der Terminologie des Science-fiction-Romans entlehnt erscheint? „Mutanten“ sind bei Grothendieck Menschen, die sich in spiritueller Hinsicht von „gewöhnlichen Sterblichen“ unterscheiden; sie sind vor allem ihrer Zeit voraus und kündigen das bald kommende „Neue Zeitalter“ an. Er gibt an einer Stelle des Textes folgende Erklärung dieses Begriffes (in der Übersetzung leicht gekürzt):
Es hat in diesem Jahrhundert (wie zweifellos in vergangenen auch) eine gewisse Zahl von einzelnen Menschen gegeben, die in meinen Augen als „neue Menschen“ erscheinen, Menschen die plötzlich als „Mutanten“ auftauchen und die in der einen oder anderen Weise schon jetzt den „Menschen von morgen“ verkörpern, den Menschen in vollem Sinn, der ohne Zweifel sich in den kommenden Generationen entwickeln wird, in dem „nach-Herden“-Zeitalter, dessen Beginn nahe bevorsteht und das sie stillschweigend ankündigen.
Zur Einordnung und Erklärung ist zu sagen, dass sich Grothendieck etwa ab dieser Zeit dem (christlichen) Mystizismus annähert und die Vorstellung eines bald bevorstehenden „Jüngsten Gerichtes“, eines „Tages der Wahrheit“ und eines darauf folgenden „Goldenen Zeitalters“ entwickelt. Zum Beispiel schreibt er am 18.2.1987 an seine deutschen Freunde AB und CD:
Ich wäre interessiert, etwas über „Mystiker“ zu erfahren, nämlich über Menschen, die aus einem unmittelbaren Verkehr mit Gott ein Wissen über „spirituelle Dinge“ schöpfen und ein solches Wissen vertiefen. Es geht mir also nicht um „Erlebens-Mystiker“, denen in erster Linie oder ausschliesslich daran gelegen ist, in einem Zustand der Verklärtheit oder der Glückseligkeit zu verweilen, sondern um die, die von einem Wissensdurst getrieben sind, die eigene Psyche bzw. „Seele“ und deren Beziehung zu Gott (oder dem Tao, oder dem All, oder wie man Ihn oder Es nennen mag) kennenzulernen. Es wäre interessant, Schriften solcher Menschen zu lesen – vielleicht gehört Meister Eckehart, St. Theresa von Avilla zu ihnen – ...
Tatsächlich tritt Grothendieck um diese Zeit in eine spirituelle Verbindung mit der stigmatisierten katholischen Mystikerin Marthe Robin (1902 – 1981). Er erwähnt sie im Juni 1987 zum ersten Mal in La Clef des Songes.
Diese Frau aus dem Departement Drôme erkrankte schon als Heranwachsende schwer, war ab ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr zunehmend gelähmt ans Bett gefesselt und erblindete schließlich. Es wird berichtet, dass sie fünfzig Jahre lang keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich nahm, sie lebte von der Eucharistie allein und durchlebte jeden Freitag die Passion Christi. Eine große Anhängerschaft strömte jahrzehntelang zu dem einfachen Raum mit ihrem Lager und erhoffte sich Beistand, Erleuchtung und Heilung. Einige Jahre nach ihrem Tode wurde Marthe Robin von der katholischen Kirche selig gesprochen.
Etwa ab 1988 ist Grothendieck im Zuge seiner Meditationen und Fastenperioden zeitweise davon überzeugt, dass Gott durch Marthe Robin zu und aus ihm spricht. (Allerdings spielt auch eine andere Gottheit oder ein Engel eine Rolle: er nennt diese „Flora“ oder „Lucifera“, je nach dem ob er die göttliche oder teuflische Seite hervorheben will.) Freunde, die ihn während dieser Zeit besucht haben, be¬stätigen, dass er in der Tat zeitweise wie von Sinnen mit völlig veränderter, nahezu unverständlicher wiehernder Stimme gesprochen habe.
In den Sommer 1988 fällt dann eine dramatische und bestürzende Episode religiöser Verzückung, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er beginnt eine Fastenperiode, in der er sich – nach eigener Aussage – auch weigert, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Er ist entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen, er will Gott – oder Marthe oder Flora – zwingen sich zu offenbaren. Vielleicht wollte er auch den Augenblick des Todes bewusst erleben. In kritischem Zustand, als er schon nicht mehr gehen oder sprechen kann, wird er dadurch gerettet, dass einige Frauen aus seinem Umkreis sich unter seinem Fenster versammeln und einen Gesang anstimmten: „Marthe will mit dir sprechen, Marthe hat eine Botschaft für dich ...“ Offenbar hat dieses Ereignis keine bleibenden körperlichen Schäden bei Grothendieck hinterlassen (und Marthe Robin hat noch nach ihrem Tod jedenfalls das Wunder vollbracht, einem der größten Mathematiker aller Zeiten das Leben zu retten.)
Andeutungen über das bevorstehende „Neue Zeitalter“ finden sich gelegentlich in Unterhaltungen und Briefen aus dieser Zeit, wenn auch in meistens in etwas kryptischer Form. Zum Beispiel schreibt er am 24.7.1989 an Ronald Brown:
Incredible things are going to happen, Ronnie, to every single soul on the earth, before the end of this century – and we both will be around to take part in it. But for the time being I wont say more about this tremendous, burning topic.
Etwa ein und ein halbes Jahre später schreibt er dann den berühmt-berüchtigten Brief von der Guten Neuigkeit - Lettre de la Bonne Nouvelle -, in dem er etwa 250 Korrespondenten den Beginn des „Neuen Zeitalters“ für den 16.10.1996 ankündigt. Aus diesem Brief spricht zwar von der ersten bis zur letzten Zeile religiöser Wahn, aber er enthält – abgesehen von seinem persönlichen Erleben – doch eine Art apokalyptische Vision. Es soll an dieser Stelle nur insoweit auf ihn eingegangen werden, als wir einen Abschnitt zitieren, aus dem noch einmal deutlich wird, in welchem psychischen und emotionalen Zustand sich Grothendieck befand, als er La Clef des Songes und die zugehörigen Notes schrieb.
7. Mein religiöser Unterricht. ... Im wachen Zustand hat Gott Sich mir zum ersten Mal am 27. Dezember 1986 zu erkennen gegeben. An diesem Tag begann auch eine sehr intensive Periode „metaphysischer“ Träume, die bis März 87 anhielt und den Beginn eines „religiösen Unterrichts“ darstellt, der (fast ohne Unterbrechung) bis heute fortgedauert hat. Zudem kamen mir zwischen dem 8. Januar 87 und dm 30. April 89 an die fünfzig prophetische Träume, die mich, in der symbolischen Sprache der Träume, über den nah bevorstehenden grossen Tag der Läuterung und der Verwandlung unterrichteten, und die mir dann, nach und nach, gewisse Aufschlüsse gaben über das Neue Zeitalter, in das wir an jenem Tag eintreten werden. Und schon im Oktober 86 war mir durch einen Traum offenbart worden, dass die Träume überhaupt Gottes Werk und Wort sind, um Seine sehr persönlichen Mitteilungen an die Seele zu richten. Zudem erhielt ich besondere Hilfe Gottes für ein Verständnis zahlreicher metaphysischer und prophetischer Träume (von Januar 87 bis April 89), die mir sonst sicher allesamt ein Rätsel geblieben wären.
Seit dem 14. Juni vorigen Jahres ist ein drastischer Wendepunkt in der Kommunikation eingetreten. Diese geschieht nunmehr in täglichen intensiven Gesprächen, die fast völlig meine Zeit und Energie in Anspruch nehmen und bis in die letzten Tage fortdauerten. In diesen Gesprächen wurde ich aufs Ausführlichste und Genauste aufgeklärt, sowohl über Gottes Vorhaben betreffs des Neuen Zeitalters und der Ereignisse, die vor dem Tag der Wahrheit stattfinden sollen, als auch über die sehr besondere Aufgabe, die Er mir dabei zuordnet. Ich wurde gleichfalls aufgeklärt über das Seelenleben des Menschen überhaupt, dessen Beziehung zu Gott, die Geschichte des Alls und den grossen göttlichen Plan der „Erlösung“ seit der Erschöpfung der Welt, und auch über den Sinn des Leidens und den des „Bösen“ in Gottes grossem Rat, seit Urbeginn der Zeiten und in der Perspektive des ewigen Lebens der Seele.
Mein „Lehrer“, oder vielmehr meine Lehrerin, blieb dieselbe von Anfang an. Doch gab sie sich im Lauf der Wochen und Monate unter verschiedenen Identitäten (und zwar von Engeln), mit wechselnden Namen und auch wechselnden Stimmen – ein Mittel unter vielen anderen, um mich zu verwirren und auf die Probe zu stellen. Sie ist jedenfalls ein Geist, der sich mir durch eine, sowohl mir selbst als auch andern Menschen klar und deutlich hörbare Frauenstimme äussert; und zwar eine Stimme die (beim Einatmen, statt wie sonst beim Ausatmen) aus meinem Munde erklingt, als wäre es eine zweite, „komplementäre“ Stimme. (Doch nur soweit ich einwillige.) Meist äussert sie sich, um Antwort auf Fragen zu geben, die ich mündlich oder aber auch nur gedanklich an sie richte. Das Gespräch kann auch rein gedanklich vor sich gehen, ohne Begleitung physisch hörbarer Töne. Die Kommunikation kann aber auch auf einer weder gedanklichen noch sinnlichen Ebene stattfinden; so etwa wie auf der Ebene des Liebesempfindens, der Gefühle und der Emotionen. Und oftmals singen wir miteinander und es ist wie ein Reigen – von Licht und Schatten, Tag und Nacht ...
Dies Guru-Wesen blieb schliesslich beim Namen „Flora“, und seit dem 22. September gibt sie sich als „Gott-yin“, oder „die göttliche Mutter“, nämlich als die weibliche Person Gottes (in Gottes Beziehung zu mir persönlich ...). Im Lauf der Wochen wurde die Beziehung zu ihr eine intime und vertraute, und Anfang Dezember wurde „Flora“ schliesslich zu „Mutter“ oder „Mutti“. Doch muss ich sogleich erläutern, dass besagte Flora oder „Mutti“, ganz abgesehen von einer schwindelnden geistigen Überlegenheit über meine bescheidene Person, einen derart tiefen Einblick in meine und anderer Menschen Psyche hat, ein derartiges Wissen um jegliche Dinge unter und über dem Himmel (soweit ich dies beurteilen kann), und zudem und vor allem eine derartige Macht sowohl über meine Psyche als auch über meinen Körper oder über äussere Dinge, dass es mir sehr schwer gefallen wäre, an ihrer göttlichen Identität zu zweifeln.
Wenn es dennoch geschah, zu Zeiten der Zerrissenheit und hilflosen Verwirrtheit, so war die verzweifelte Frage die, ob Flora nicht weit eher der leibhaftige Teufel in Frauengestalt, „Lucifera“ wäre, dem Gott für eine Zeit lang Gewalt über mich gab, um mich aufzuklären und mich zugleich seelisch zu zerfleischen – und es dabei mir überliess, mich da herauszukämpfen schlecht oder recht, und meine dürftigen geistigen und spirituellen Fähigkeiten einzusetzen, um mich in einer Situation geradezu teuflischer Wirre und Vieldeutigkeit und (wie es zwingend erschien ...) offensichtlicher Bösartigkeit zurechtzufinden, und dies auszutragen: bei Zeiten zärtlich umsorgt und aufs Grossartigste instruiert; dann wieder (mit einer für den armen menschlichen Geist geradezu unvorstellbaren Raffiniertheit ...), mit nachlässig-beiläufigem Gebaren in dem, was mir am teuersten, was in der Seele am zartesten und am schmerzhaftesten versehrbar ist, zerstört, verraten und verhöhnt ...; und fast allzeit systematisch belogen und betrogen ...
Bei diesem Hintergrund ist es vielleicht überraschend, dass Les Mutants eine jedenfalls streckenweise durchaus interessante und lesenswerte Meditation über eine Reihe bemerkenswerter Persönlichkeiten ist. Die Lektüre ist auch deshalb lohnend, weil Grothendieck, anders als in Recoltes et Samailles und La Clef des Songes, nicht in erster Linie über sich selbst spricht, sondern über andere, eben die „Mutanten“. Zweifellos ist deren Auswahl sehr zufällig, aber jeder Leser wird über diese Menschen viel erfahren, das er noch nicht gewusst hat.
Vermutlich möchte der Leser die Liste der Mutanten jetzt erst einmal sehen. Hier ist sie, so wie Grothendieck sie selbst zusammengestellt hat (mit einigen nicht korrekten Jahreszahlen). In dieser Liste taucht mehrfach das Wort „Lehrer“ (instructeur im Original) auf, das erläutert werden müsste. Das Wort savant wird mit Gelehrter, nicht mit Wissenschaftler, übersetzt.
1. C. F. S. Hahnemann (1755 – 1843): deutscher Mediziner und Gelehrter, erneuerte die Medizin seiner Zeit.
2. C. Darwin (1809 – 1882): englischer Naturwissenschaftler; Gelehrter.
3. W. Whitman (1819 – 1892): Journalist, amerikanischer Dichter und Schriftsteller; Dichter und Lehrer.
4. B. Riemann (1826 – 1866): deutscher Mathematiker; Gelehrter.
5. Râmakrishna (1836 – 1886): indischer (hinduistischer) Prediger, Lehrer.
6. R. M. Bucke (1837 – 1902): amerikanischer Mediziner und Psychiater; Gelehrter und annonciateur.
7. P. A. Kropotkine (1842 – 1921): russischer Geograph und Gelehrter; anarchistischer Revolutionär.
8. E. Carpenter (1844 – 1929): Pfarrer, Bauer, englischer Denker und Schriftsteller; Lehrer.
9. S. Freud (1856 – 1939): österreichischer Mediziner und Psychiater; Gelehrter und Schöpfer der Psychoanalyse, Schlüssel zu einem neuen wissenschaftlichen Humanismus.
10. R. Steiner (1861 – 1925): deutscher Gelehrter, Philosoph, Schriftsteller, Redner, Pädagoge ... ; visionärer Lehrer, Schöpfer der Anthroposophie.
11. M. K. Gandhi (1881 – 1955): indischer Advokat und Politiker; Lehrer, setzte sich für die Verbreitung der ahimsa (Gewaltlosigkeit) ein.
12. P. Teilhard de Chardin (1881 – 1955): französischer (Jesuiten-) Pater und Paläontologe; (christlicher) religiöser ökumenischer Denker, mystischer Visionär, arbeitete für eine Versöhnung von Religion und Wissenschaft.
13. A. S. Neill (1883 – 1973): englischer Lehrer und Erzieher; Erzieher, der sich für eine Erziehung in Freiheit einsetzte.
14. N. Fujii (genannt Fujii Guruji) (1885 – 1985): japanischer buddhistischer Mönch; Lehrer.
15. J. Krishnamurti (1895 – 1985): Redner, indischer religiöser Denker und Schriftsteller; Lehrer.
16. M. Legaut (1900 - ...): Universitätslehrer, Bauer, französischer christlicher religiöser Denker und Schriftsteller, Schüler von Jesus von Nazareth, arbeitete für eine Erneuerung des Geistes des Christentums.
17. F. Carrasquer (1904 - ...): spanischer Volksschullehrer und Erzieher; Erzieher und militanter Anarchist, für eine „selbstbestimmte“ Schule und Gesellschaft.
18. ... Solvic (1923? ... 1945): amerikanischer Arbeiter und kleiner Angestellter; anscheinend ohne jede besondere Berufung.
Wir werden längst nicht alle dieser Personen besprechen und beginnen mit denen, die Grothendieck persönlich kennen gelernt hat.
2. Marcel Légaut
Während der Arbeit an La Clef des Songes wird Grothendieck mit den Büchern des christlichen Denkers Marcel Légaut bekannt, die ihn zutiefst beeindrucken und seinem eigenen Denken eine neue Richtung geben. Es handelt sich vor allem um die Werke L'homme à la recherche de son humanité und Introduction à l´intelligence du passé et de l´avenir du christianisme. Es scheint, dass zumindest am Anfang seiner Lektüre Grothendieck nichts über das Leben Légauts weiß, das eine Reihe von bemerkenswerten Übereinstimmungen mit seinem eigenen aufweist.
Marcel Légaut (1900-1990) besuchte die französische Elite-Schule École Normale Superieure, und wird nach seinem Studium Professor für Mathematik an den Universitäten Nancy, Rennes und Lyon. Im Alter von 40 Jahren gibt er – auch unter dem Eindruck des Krieges – die gesicherte Universitäts-Laufbahn auf, um als Bergbauer und Schafzüchter auf einem einsamen Bauernhof im Departement Haut-Diois zu leben. Er heiratet, hat sechs Kinder, meditiert über seinen christlichen Glauben und seine Berufung und führt ein „spirituelles“ Leben. Nach mehr als zwanzig Jahren des Nachdenkens entschließt er sich, seine Gedanken, Meditationen, Überzeugungen, „seine Botschaft“ aufzuschreiben; die oben genannten Bücher entstehen. Sie weisen ihn weder als einen Theologen noch als einen Philosophen im eigentlichen Sinne aus, aber doch als jemanden, der von einem gewissen persönlichen Standpunkt aus tief in die Natur des Menschen und seine Stellung in der Welt eingedrungen ist. Die oben benutzte Charakterisierung als „christlicher Denker“ ist wohl die treffendste, die man in zwei Worten geben kann. Trotz aller Kritik an der Kirche wendet er sich nicht von dieser ab; die Treue auch zur (oft fraglichen und angreifbaren) Institution der Kirche ist ein ganz wesentlicher Teil seiner eigenen Religiosität und seiner Botschaft. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. Obwohl er nicht wirklich berühmt wird, sammelt er eine große Anhängerschaft, eine „Gemeinde“ um sich herum. Es kann kein Zweifel sein, dass er durch seine Schriften und durch das Vorbild seines eigenen Lebens vielen Menschen den Weg gewiesen hat.
Es scheint mir, dass Teile der Botschaft Légauts auch von Menschen, die der Kirche fernstehen und denen jede Religion suspekt oder völlig gleichgültig ist, sogar von dezidiert Ungläubigen und Atheisten in gewissem Umfang verstanden, aufgenommen, angenommen und akzeptiert werden können. Dies hängt einfach damit zusammen, dass er sich gründlich, aber auch sehr klar und direkt mit der Natur des Menschen und seiner Bestimmung beschäftigt, und zwar in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Es hängt auch damit zusammen, dass Leben und Werk Légauts außerordentlich einheitlich – „aus einem Guss“ – erscheinen und dadurch sehr an Überzeugungskraft gewinnen. Man findet bei ihm Ruhe und Sicherheit, man ist geneigt, seinen Worten zu vertrauen. (In Grothendiecks Leben empfinden wir dagegen Unrast, Brüche und Widersprüche, auch Unsicherheit in Bezug auf ganz einfache menschliche Dinge und Verhältnisse, die es schwer – vielleicht manchmal unmöglich – machen, in seine Gedankenwelt einzudringen.) Légaut verleitet zur Zustimmung, Grothendieck zum Widerspruch.
Wie dem auch sei, Grothendieck ist jedenfalls von Légaut so beeindruckt, dass sich La Clef des Songes in Richtung einer Analyse der Religion, des Glaubens, des spirituellen Lebens und des göttlichen Wirkens im einzelnen Menschen entwickelt. Es ist offensichtlich, dass auf halbem Weg, ab Juni 1987 dieses Werk eine neue Richtung nimmt. Wir zitieren zunächst einige Bemerkungen zu Légaut:
19.6.87: Ich habe in den letzten Tagen auch die Freude gehabt, mit der Kenntnisnahme des Buches L´homme à la recherche de son humanité von Marcel Légaut zu beginnen, und ich glaube, in dem Autor einen wahrhaft spirituellen „älteren Bruder“ [im Original aîne, ein Schlüsselwort dieser Meditationen] zu erkennen. Von christlicher Inspiration geleitet bezeugt dieses bemerkenswerte Buch eine innere Freiheit, eine außerordentliche Klarheit und zugleich die Erfahrung eines spirituellen Lebens und eine Tiefe der religiösen Vision, von der ich weit entfernt bin sie zu erreichen.
29./30.6.87: Légaut selbst mit der Klarsicht eines Visionärs, aber auch mit extremer Strenge und mit Bescheidenheit zeigt den Weg zur Erneuerung – nicht den Weg einer Truppe von „getreuen Gefolgsleuten“ einer toten Botschaft, sondern denjenigen, den jeder, der an Jesus glaubt, früher oder später in seinem Leben finden muss, in der Verborgenheit seines Herzens und in der Treue zu sich selbst.
18.7.87: Ich habe in den letzten Wochen reichlich Gelegenheit gehabt, zur Botschaft Marcel Légauts zurück zu kommen, die von einzigartiger Bedeutung für die heutige Welt in ihrem ganzen spirituellen Niedergang ist.
Es scheint, dass die Begegnung mit dem Werk Légauts einer der entscheidenden Anstöße gewesen ist, Les mutants zu schreiben, und Légaut ist einer dieser „Mutanten“. Offensichtlich wollte Grothendieck dann auch Légaut persönlich kennen lernen. Er hat ihn, der nicht weit entfernt wohnte, am 6.11.1987 für ein bis zwei Stunden besucht. Eine entsprechende kurze Fußnote findet sich in den Notes. Zu einem näheren Kennenlernen ist es aber offensichtlich nicht gekommen; Légaut war zu dieser Zeit ja auch schon 87 Jahre alt.
3. Fujii Guruji
Bevor Grothendieck näher mit christlichem Denken in Berührung kam, hatte er schon eine intensive Phase der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus hinter sich, deren Höhepunkt nach eigener Aussage (Notes S. 236) in den Zeitraum 1974 – 1978 fiel. Die Einzelheiten dieser Begegnung mit fernöstlichem Denken konnten bisher nicht vollständig entwirrt werden. Jedoch scheint (etwas überraschend) die Initiative zu diesem Kontakt nicht von Grothendieck, sondern von der von Fujii Guruji (1890 – 1990) begründeten Sekte Nihonzan Myohoji (etwa „Japanische Gemeinschaft des wunderbaren Lotos-Sutra“) ausgegangen zu sein. Grothendieck schreibt dazu (Notes S. 200), dass der Mönch Fukuda shonin in einer japanischen Zeitschrift einen Artikel über Grothendiecks ökologische und antimilitaristische Aktionen im Rahmen der Gruppe Vivre et Survivre und seine Stellungnahmen zur Problematik der Wissenschaft und der naturwissenschaftlichen Forschung gelesen und daraufhin den Kontakt zu Grothendieck gesucht habe. Ein erster Missionar erschien „mir nichts dir nichts“ am 7.4.1974 bei Grothendieck. Später hat Fukuda selbst Grothendieck zweimal besucht (zuletzt um die Jahreswende 1977/78), was insofern bemerkenswert ist, als Fukuda ansonsten niemals Japan verlassen hat und, wie Grothendieck (in einem Brief an AB und CD) berichtet, kein einziges Wort irgendeiner europäischen Sprache sprach. Es ist also nicht verwunderlich, dass ab 1978 der Kontakt wieder eingeschlafen ist.
Bei diesem Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten haben sicher andere eine wesentliche Rolle bei der Verbindung zwischen Grothendieck und dem Orden Nihonzan Myohoji gespielt, offenbar vor allem der Mönch und Mathematiker Oyama und außerdem Kuniomi Masunaga. Beide haben Grothendieck in Paris und später auch in Villecun und möglicherweise noch in Les Aumettes besucht.
Masunaga war der Anlass des Prozesses gegen Grothendieck in Montpellier im Jahr 1977 wegen „Aufnahme und Beherbergung eines illegal anwesenden Ausländers“. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1945 war noch niemals angewandt worden. Grothendieck, selbst viele Jahre seines Lebens ein Flüchtling und ein Illegaler, setzte alles daran, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses antiquierte Gesetz zu richten. Er startete eine öffentlich Kampagne und schrieb unter anderem einen offenen Brief an den Präsidenten der Republik. Offenbar setzte er in Michael-Kohlhaas-Manier alles daran, ins Gefängnis zu kommen. Der Prozess gegen den exzentrischen, aber immer noch weltberühmten Wissenschaftler wurde schließlich niedergeschlagen.
Es ist offensichtlich, dass es zwischen der kompromisslos antimilitaristischen Bewegung Nihonzan Myohoji und Grothendiecks gleich konsequenter Gruppe Vivre et Survivre Berührungspunkte gab. Beide kämpften für den Weltfrieden und als notwendige Voraussetzung dafür für die Abrüstung, insbesondere die Abschaffung aller Atomwaffen. Hiroshima erschien Grothendieck als das apokalyptische Menetekel für die Menschheit überhaupt, schlimmer noch als der Holocaust und Auschwitz. (Bei seiner eigenen Biographie und der seiner Eltern hätte man vielleicht etwas anderes erwarten können.) Wir zitieren im Original einen gesperrt geschriebenen (und damit besonders hervorgehobenen) Satz aus den Notes (S. 204):
Ce grand feu qui a embrasé Hiroshima, c´était le signe de grand Feu qui déjà embrase la Maison des Hommes !
Man kann sich auch leicht vorstellen, dass die japanischen Bettelmönche des Ordens Nihonzan Myohoji, die man in den Straßen der Großstädten antraf, die die Trommel schlugen und endlos die sieben heiligen Silben na my myo ho ren ge kyo wiederholten, die keine andere Bestimmung auf dieser Erde kannten, als den Lehren Buddhas, des Propheten Nichiren und des Erneuerers Fujii Guruji zu folgen, die Gewaltlosigkeit und Frieden forderten und in vielen Städten stupas – Friedenspagoden – errichteten, dass diese oft einfachen und ungebildeten Menschen Grothendieck beeindruckten.
Wer ist nun dieser Fujii Guruji, und was ist der Orden Nihonzan Myohoji?
Nichidatsu Fujii wurde 1885 als Sohn armer Bauern in Japan geboren. (Den Beinamen Guruji erhielt er erst später, angeblich von Gandhi.) Mit 19 Jahren wurde er Mönch und vertiefte sich in die Gedankenwelt des Buddhismus. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann seine Mission als Prediger des Weltfriedens, der Gewaltlosigkeit und der spirituellen Erneuerung des Buddhismus. Er gründete den Orden Nihonzan Myohoji, der den Lehren des Propheten Nichiren (1222 - 1282) verpflichtet ist. Er betete für den Frieden, fastete, organisierte Friedensmärsche; seine Anhänger errichteten die ersten Shanti Stupas – Friedenspagoden. Von 1918 bis 1923 durchwanderte er auf seiner Mission Korea, China und die Mandschurei. Man muss sich diese Mission auf ihre einfachst mögliche Form reduziert vorstellen: Er reiste von Stadt zu Stadt, durchwanderte die Straßen, schlug dabei unaufhörlich die Trommel und rezitierte ununterbrochen die Mantra na my myo ho ren ge kyo. Überfall fanden sich Anhänger, vielleicht nur wenige, die ihm folgten, im direktesten Sinne des Wortes. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1923 kehrte er nach Japan zurück, um spirituellen Beistand zu leisten. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1930 beschloss er, den Buddhismus in seinem Ursprungsland Indien, wo dieser inzwischen fast vollständig erloschen war, zu erneuern. Er begann seine Pilgerreise in Kalkutta, die ihn dann durch den ganzen Subkontinent bis nach Ceylon führte. In vielen größeren Städten wurden mit einfachsten Mitteln in Handarbeit mit selbst hergestellten Werkzeugen und mit grenzenloser Geduld Tempel errichtet. 1933 traf er zum ersten Mal Matamaji Gandhi, der von der Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit Fujiis zutiefst beeindruckt war. Während des Zweiten Weltkrieges setzte Fujii seine Mission fort; er sang die Mantra und schlug seine Trommel. Bei der Einweihung eines der größten Friedenstempel in Kumamote organisierte er 1954 eine große Welt-Friedenskonferenz. Ähnliche Konferenzen wiederholten sich in den folgenden Jahren in mehreren Ländern. Er bereiste die kommunistischen Länder China, Sowjetunion und die Mongolei; selbst in China errichtete er Friedenspagoden. Alle indischen Staatspräsidenten empfingen ihn. 1968 weihte der indische Staatspräsident die Friedenspagode in Rajgir ein; das große Ziel der Erneuerung des Buddhismus in Indien war erreicht. Als er schon über 90 Jahre alt war, kam Fujii zum ersten Mal nach Frankreich, um in Europa seine Mission fortzusetzen, und traf bei dieser Gelegenheit auch Grothendieck. Er starb 1985 in seinem hundertsten Lebensjahr. Es ist sein Verdienst, dass der Buddhismus in Indien wieder Fuß gefasst hat.
Fujii sah durchaus, dass gerade in Asien Christentum und Islam sich stärker ausbreiten als der Buddhismus, aber er war zutiefst davon überzeugt (vielleicht mit Berechtigung, wenn man die aggressiven Erscheinungsformen von Islam und Christentum über lange Perioden ihrer Geschichte bedenkt), dass nur der Buddhismus die Welt zum Frieden führen kann.
Es ist nicht ganz klar, wann und wie Grothendieck und Fujii sich zum ersten Mal persönlich getroffen haben; die Meditationen geben darüber keine genaue Auskunft. Es könnte bei der Einweihung eines buddhistischen Tempels in Paris gewesen sein. Grothendieck hatte sich an den Kosten der Einrichtung beteiligt und bei der feierlichen Eröffnung als prominentes Mitglied der Gesellschaft eine Rede gehalten. Später, nämlich Anfang November 1976, hat Fujii Grothendieck in Begleitung von Fukuda und Ygii-ji shonin für einige Tage in Villecun besucht. Einzelheiten werden in Les Mutants nicht mitgeteilt. (Es ist ganz generell so, dass Grothendieck in seinen Meditationen konkrete Fakten und Ereignisse nur sehr sparsam mitteilt.)
Wir zitieren jetzt einige Bemerkungen aus Les Mutants, die Grothendiecks Verhältnis zum Buddhismus, zur Sekte Nihonzan Myohoji und zu Fujii Guruji beleuchten, die klar machen, warum er Fujii Gurujii in die Liste der Mutanten aufgenommen hat, und zugleich immer auch seine eigenen Ansichten widerspiegeln:
Meines Wissens ist die Gruppe Nihonzan Myohoji die einzige religiöse Gemeinschaft der Welt, deren einziger Daseinszweck, untrennbar von ihrer religiösen Berufung, der gewaltlose Kampf für den Weltfrieden ist, verbunden mit einer totalen Ablehnung der Militärapparate und ständiger Aktion für deren Beseitigung (S. 184).
Fujii Guruji ist gleichermaßen einer der sehr seltenen Spirituellen gewesen, der in all seiner Dringlichkeit, in all seiner Schärfe und all seiner Bedeutung die gegenwärtige Krise der Zivilisation erkannt hat, sowie die Drohung der bevorstehenden totalen Zerstörung der Art Mensch durch die vereinten, untrennbar miteinander verbundenen Effekte der rasenden Entspiritualisierung der Geisteshaltungen und der Proliferation der Massenvernichtungswaffen. Er hat klar gesehen, dass auf kurze Sicht das Weiterbestehen des Lebens auf dieser Erde untrennbar verbunden ist mit einer profunden spirituellen Erneuerung [mutation], von einer Revolution der Geisteshaltungen von einer Weite und Tiefe ohne Vorbild. (S. 185)
In einer Fußnote zu diesem Abschnitt macht Grothendieck Bemerkungen, die sicher sehr charakteristisch für seine eigene Sicht der Dinge sind:
Für meinen Teil glaube ich, dass die Entspiritualisierung der modernen Welt und die senile Degeneration des religiösen Geistes im Keim schon in den religiösen Institutionen selbst angelegt sind und in Wirklichkeit mit anderen zu den Symptomen dieser „Kinderkrankheit“ der Welt gehören, die dabei ist den Höhepunkt der Krise zu erreichen und sich dann auflösen wird. Die traditionelle Opposition von „Wissenschaft“ und „Religion“ scheint mir ein anderes dieser Symptome zu sein, ...
... und jetzt noch einige weitere Zitate zu Fujii:
Auch ist Guruji einer der sehr seltenen Spirituellen gewesen, der klar den wesentlichen Unterschied zwischen der intellektuellen Dimension und der spirituellen Dimension des menschlichen Seins gesehen hat, und der gewusst hat, dass Lehre [doctrine] und Theologie in den Bereich des Intellekts gehören und dass Glaube, Liebe und Hoffnung in den Bereich des Geistes [esprit] gehören. Und er hat instinktiv gewusst, dass die Krise aller Krisen [im Original mit großen Anfangsbuchstaben] nicht durch den Intellekt gelöst werden wird, sondern durch den Geist – nicht durch die Intelligenz des Kopfes (die zweitrangig ist), sondern durch den Glauben. (S. 186)
Die vielleicht bemerkenswerteste (wenn auch etwas abwegige) Tatsache über Grothendiecks „buddhistische Phase“ ist die, dass offenbar ernsthaft davon die Rede war, ihn zum Nachfolger des inzwischen über neunzigjährigen Fujii zu machen. Dies war insbesondere auch der Wunsch des Meisters selbst. Es ist offensichtlich, dass ein Vorhaben dieser Art nicht auf dem offenen Markt gehandelt wird. Grothendieck spricht in einem Brief vom 4.8.1976 an seine deutschen Freunde von dieser Angelegenheit:
Und was wird aus mir – dem von Oyama entdeckten bzw. zusammengeheckten (unheiligen) Heiligen? So wenig ich mich auch für die mir zugedachte Rolle eigne und so wenig ich mich ihr füge – das Heiligenbild für die Fujii-Guruji-Jünger steht scheinbar festgefügt und unversehrt wie je, und meine gelegentlichen Bemühungen, es aus dem Leim zu bringen, scheinen aussichtslos. Darüber allein liesse sich schon ein ganzes Buch schreiben – lassen wir es ungeschrieben, liebe Freunde! Und kehren wir zurück zur Privatperson ...
Diese Freunde berichten, dass Grothendiecks Interesse am Buddhismus etwas einseitig und wenig „theoretisch“ war. Zum Beispiel habe er sich nicht sonderlich für die Schriften dieser Religion interessiert und sie auch nicht gründlich studiert. Allerdings ließ er sich einige Zeit lang von einem Meister einweisen, er richtete sich noch in Les Aumettes einen Gebets- und Meditationsraum ein (der vielen Besuchern als Unterschlupf zur Verfügung stand), er besaß eine große Trommel, die er selbst und die Mönche, die ihn besuchten, schlugen. Im Grunde besteht aber ein unlösbarer Widerspruch zwischen der Botschaft des Buddhismus, der ja vor allem die Selbstaufgabe in den Mittelpunkt stellt, und dem egozentrischen, oft geradezu egomanischen Charakter Grothendiecks. (Damit soll nicht etwa abgestritten werden, dass Grothendieck in seinem Verhalten gegenüber anderen in vielen Fällen ganz außerordentlich hilfsbereit, großzügig und freigiebig war. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er in seinen Gedanken und Meditationen niemals von sich selbst loskam.)
Im Anschluss an Fujii bespricht Grothendieck dann ausführlich das Leben und Wirken von Mathama Gandhi, ebenfalls einer auf der Liste der 18 Mutanten. Er erkennt viele Gemeinsamkeiten zwischen Fujii und Gandhi, vor allem im Prinzip der Gewaltlosigkeit, der Bedeutung der Spiritualität und der völligen Gleichgültigkeit (oder sogar Ablehnung) gegenüber der Wissenschaft.
4. Félix Carrasquer
Der einzige der mutants, zu dem Grothendieck über längere Zeit eine enge persönliche Verbindung gehabt hat, ist Félix Carrasquer (1905 – 1993). Er nennt ihn seinen ältesten und besten Freund. Genaues über diese Beziehung konnte aber nicht ermittelt werden. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie sie sich kennen gelernt haben. Carrasquer war ein spanischer Anarchist und – wie wir noch sehen werden – ein bemerkenswerter Schulreformer. Vielleicht finden wir in der Freundschaft mit ihm einen Widerhall des anarchistischen Vermächtnisses seines Vaters. In jedem Fall kann man feststellen, dass Carrasquer mit seinem höchst abenteuerlichen Lebenslauf sich nahtlos einfügt in die Reihe der Menschen, die Grothendieck nahe standen und in seinem Leben eine Rolle spielten.
Grothendieck widmet etwa vierzig Seiten von Les Mutants der Biographie und dem Lebenswerk seines Freundes. Man kann diese Seiten, anders als das meiste, was Grothendieck sonst geschrieben hat, als eine „hommage an einen Freund“ lesen, und wir zitieren jetzt (in etwas freier Übersetzung) aus diesem Text, wobei wir die einzelnen Abschnitte zeitlich ordnen und teilweise etwas kürzen. Wir zitieren etwas ausführlicher, als es für die Zwecke dieses Essays erforderlich wäre, um auf die wenig bekannte Persönlichkeit Carrasquers aufmerksam zu machen. Grothendiecks eigener Text ist unterbrochen durch Zitate aus Briefen von Carrasquer, die durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind.
Félix verbrachte die ersten vierzehn Jahre seines Lebens in dem Dorf, in dem er [1905] geboren wurde, in Albate de Ciena, wo sein Vater Gemeindesekretär war. Ein lebendiges und wissbegieriges Kind, lernte er schon früh lesen und verschlang alles gedruckte, das ihm in die Hände fiel. Er brannte darauf mit den größeren Kindern endlich zur Schule zu gehen. Aber als es endlich so weit war, verbrachte er keinen einzigen Tag in der Schule. Abgestoßen von der Brutalität und dem Stumpfsinn, der sich dort zur Schau stellte, rettete er sich schon am zweiten Tag ... Seine Eltern waren vernünftig genug, nicht darauf zu bestehen, dass er wieder zur Schule zurück kehrte. Er verbrachte seine Kindheit in vollständiger Freiheit, ... Abgesehen von diesem ersten Versuch im Alter von sechs Jahren setzte er nie wieder einen Fuß in eine staatliche Schule – schon gar nicht als Schüler. Er hat niemals ein Examen gemacht, kein pädagogisches oder irgend ein anderes. Aber das verhinderte nicht, dass er schon von frühem Alter an eine Passion für Erziehung entwickelte und zugleich eine Passion für die Schule – aber eine Schule würdig dieses Namens. Er sagt, dass er diese Passion nur entwickeln konnte, weil er niemals eine gewöhnliche Schule, eine Dressur-Schule, besuchte ... Ganz entschieden war es möglich etwas besseres zu machen. Und während seines ganzen Lebens, sah er das als das wichtigste an, als das, was vordringlich getan werden musste.
Schon im Alter von vierzehn Jahren kam er zu der Überzeugung, dass er in dem Dorf alles gelernt hatte, was er dort lernen konnte, und er eröffnete seinem Vater, dass er nach Barcelona gehen werde. ...
„Die Stadt und seine Bewohner verschiedenster Sorte boten vielfältige Attraktionen. Aber der Fixpunkt meiner ganzen Aufmerksamkeit war das Viertel von Atarazanas mit seinen öffentlichen Büchereien. Unendliche Schätze gab es dort zu entdecken. ...“
Es geschah in diesen Jahren, dass Félix sich eine vollständig autodidaktische Ausbildung von enzyklopädischem Umfang erarbeitete. Er fuhr fort, sein Leben bei jeder Gelegenheit zu bereichern, durch Lektüre, Unterhaltungen, Radiosendungen, Nachdenken ... Es war auch in diesen Jahren, dass ihm seine Berufung als Erzieher klar bewusst wurde und von nun an einen zentralen Platz in seinem Leben einnahm. ...
„ ... Ich war dreiundzwanzig alt, als ich mich entschloss, in das Dorf zurückzukehren um eine Arbeit zu beginnen, die meinem eigentlichen Bestreben entsprach. Die Diktatur von Primo de Rivera war zu Ende gegangen (1928), und es gab zahllose Schwierigkeiten, die Leute für eine neues Erziehungswerk zu mobilisieren. ... In diesem Augenblick kam mein Freund Justo ins Dorf zurück. Er hatte einige Jahre im Gefängnis verbracht ... In unserem ersten Gespräch schlug er vor, eine Bibliothek einzurichten. Ich gab dreißig oder vierzig Bücher aus meinem Besitz und er ein Dutzend. Und die Dinge nahmen ihren Lauf!“
Aber viele Dorfbewohner konnten nicht lesen oder, schlimmer noch, sahen nicht die Notwendigkeit, es zu versuchen. Es mussten die einen lesen lernen, um dann die anderen anzuregen, das auch zu tun, oder genauer gesagt, es mussten alle angeregt werden zu lesen, sich auszudrücken und über die Welt nachzudenken, die sie umgab. Dafür musste eine Schule gegründet werden mit Abendkursen für Kinder und Erwachsene. ...
„ ... Man konnte Junge und Alte sehen, und mit welcher Begeisterung diskutierten sie soziale Fragen, landwirtschaftliche und wissenschaftliche Probleme und alles mögliche andere! ...
Etwas später in der republikanischen Zeit und nachdem die Leute das Vermögen des Herzogs von Solférino erhalten hatten, nahm sich der Kultur-Kreis ein größeres Projekt vor und realisierte es: einen kollektiven Agrarbetrieb, ein Versuchsgut und eine Reformschule mit der Beteiligung der Jungen und der Mädchen im Alter von sechs bis vierzehn Jahren in einem Klima von Freiheit, Kooperation und Verantwortung.“
Diese erste erzieherische Erfahrung in seinem Geburtsort, die in einer Atmosphäre intensiver ideologischer und sozialer Gärung geschah, hat, wie mir scheint, das Modell für die beiden späteren pädagogischen Unternehmungen abgegeben, die denselben Grundton hatten: vollständige Freiheit und brüderliche Kooperation zwischen allen Beteiligten. Für Félix war diese Kooperation etwas ganz anderes als nur eine Frage der „Methode“, ...
Diese fruchtbare Arbeit verfolgt er fünf Jahre lang, von 1928 bis 1933; ein oder zweimal gab es wegen der gespannten politischen Lage Unterbrechungen. Das vorzeitige Ende kommt nach einem doppelten Schock. Schon 1932 machte sich bei Félix eine Retina-Degeneration bemerkbar, und einige Monate lang ist er zu vollständiger Untätigkeit verurteilt. Nach einer Besserung (die sich dann von kurzer Dauer erwies) kehrt er zu seiner Aufgabe zurück. Aber im folgenden Jahr zwingt ihn die aufgewühlte politische Situation, in der er sich vollständig und in riskanter Weise engagiert, sein Heimatdorf überstürzt zu verlassen. Er flüchtet nach Lérida, und im gleichen Jahr (1933) verliert er endgültig sein Augenlicht. Das war ein schrecklicher Schlag für diesen intensiv lebenden und aktiven Mann und gleichzeitig eine schwere Bürde, die er ein langes Leben lang tragen musste. Aber sein revolutionärer Glaube und der Glaube in seine Mission – ein Beispiel für eine neue Art der Erziehung zu schaffen – war nicht im mindesten erschüttert. Heute, ein halbes Jahrhundert später, in einer laschen Welt, die stagniert und auseinander fällt, ist dieser Glaube, diese unsinnige Hoffnung immer noch lebendig und wirksam ...
In Lérida macht er die Bekanntschaft einer Gruppe von Volksschullehrern, die beeinflusst von Freinet, auf dem Land in der Schule eine Druckerei eingerichtet hatten. Félix ist sofort von den Ideen von Freinet gefesselt. Er interessiert seinen jüngeren Broder José dafür ...
Zwei Jahre später (1935) treffen die beiden Brüder sich mit einem dritten, Francisco, und ihrer Schwester Presen in Barcelona, und mit der enthusiastischen und rückhaltlosen Unterstützung einer Gruppe neuer Freunde arbeiten sie an dem Projekt einer vollständig „selbstbestimmten“ Schule [école autogérée]. Die Examina von José erweisen sich als höchst wertvoll für die legale Gründung der Schule: es ist die „École Elysée Reclus“ in der Rue Vallespir.
Zwischenzeitlich hat Félix Gelegenheit, sich mit dem pädagogischen Denken von freiheitlich gesinnten Denkern wie Godwin, Saint Simon, Proudhon, Bakunin, Reclus bekannt zu machen. Er nimmt das mit Begeisterung auf ... Aber er sagt, dass den stärksten Eindruck auf ihn Léon Tolstoi und dessen pädagogische Erfahrungen in Yasnaia Poliana gemacht habe. ...
Die beiden wichtigsten pädagogischen Unternehmungen und Erfahrungen, die Félix gemacht hat, sind zwei „selbstbestimmte“ Schulen, die er gegründet und mit Leben gefüllt hat. ... Für ihn ist eine selbstbestimmte Schule eine Schule, die den Schülern gehört ... und in der alles, was die Schule betrifft, ohne jede Ausnahme, gemeinsam diskutiert und entschieden wird. ...
Die École Élysée Reclus war die erste selbstbestimmte Schule. Sie hat nur im Schuljahr 1935/36 richtig funktioniert; dann wurde sie vom Bürgerkrieg unterbrochen. Sie war praktisch ein Familienunternehmen, denn die vier ständigen Lehrer waren die drei Brüder und ihre Schwester ... Die Schule arbeitete unter der Schirmherrschaft und mit der Unterstützung des Comité de l'Athénée, einer liberalen und freiheitlich gesinnten Kulturorganisation, die in ganz Spanien verbreitet war. ...
Die zweite selbstbestimmte Schule, die von Félix gegründet und inspiriert wird, ist die „Schule der Kämpfer von Monzon“ [l´École des Militants de Monzon]. Es ist eine Schule auf dem Lande in Aragon, die während zweier Jahre im Bürgerkrieg von Januar 1937 bis Januar 1939 besteht. Dieses Mal ist es eine Schule für ältere Jungen und Mädchen, vierzehn- bis siebzehnjährige, die zusammen in einem Internat leben. Ihre Zahl schwankt zwischen vierzig und sechzig. Félix ist der einzige Erwachsene unter ihnen, und es ist Krieg! Während der zwei Jahre geht eine beträchtliche Zahl der älteren Jungen an die Front, die anderen widmen sich gemeinsam administrativen und organisatorischen Aufgaben im Hinterland. Neue Schüler ersetzen sie. Insgesamt durchlaufen zweihundert Schüler die Schule. ... Aragon ist während dieser Zeit in 25 Agrar-Kollektive („Comarcals“) aufgeteilt, die insgesamt 601 Dörfer mit 300000 Familien umfassen, die für eine freiwillige Kollektivierung optiert haben. Unter diesen Kollektiven ist die von Monzon, die 32 Dörfer zusammenfasst. ...
Die Hauptaufgabe der Schule ist es, den jungen Menschen den Geist der Verantwortung und Eigeninitiative zu vermitteln, die sie zur Übernahme von administrativen und organisatorischen Aufgaben für die Kollektive befähigt. ... Sehr schnell kann die Schule sich dank ihrer Agrarproduktion selbst erhalten. ... Über diese Sache schreibt mir Félix im Rückblick nach einem halben Jahrhundert:
„Die wichtigste Erfahrung in Monzon war, dass mit täglich drei Stunden landwirtschaftlicher Arbeit für jeden die ökonomische Bedürfnisse aller erfüllt werden konnten. Wenn sich diese Art von Schule allgemein einführen lässt, so heißt das also, dass die wirtschaftlichen Bedürfnisse von Millionen und Milliarden erfüllt werden können, dass man mit einer Beschäftigung der Kinder aufhören kann, die sie nur verdummt, und dass man eine wahre Verbindung von Theorie und Praxis in einer gemeinsamen Lebensweise einführen kann, die alle bereichert.“ ...
Die Schule von Monzon wurde gegründet aus den unmittelbaren Notwenigkeiten einer freiheitlichen Revolution im ländlichen Milieu, aber sicher immer auch mit Hinsicht auf eine größere Vision – die sich niemals erfüllte. Als im April 1938 Aragon [im Bürgerkrieg] fällt, wird die Schule in aller Hast nach Katalonien in die Nähe von Barcelona transferiert ... In letzter Stunde, im Augenblick der vollständigen Niederlage im Januar 1939 wird sie aufgelöst. Félix flüchtet in letzter Sekunde nach Frankreich; vier Jahre Konzentrationslager warten auf ihn – der Preis, dass er dem Erschießungskommando entkommen ist. Eine beträchtliche Zahl der Schüler von Monzon fallen an der Front. Auch sein Bruder José ...
Grothendieck berichtet dann in seinem Text ausführlich über Organisation, Arbeitsweise und Geist der von Carrasquer gegründeten Reformschulen. Er erkundigt sich während der Redaktion mehrfach in langen Telefongesprächen mit Carrasquer nach Einzelheiten und erhält offenbar auch einige Briefe von diesem. Insgesamt wird erkennbar, dass Grothendieck sich intensiv mit den pädagogischen Reformbewegungen verschiedener Art befasst hat und dass dies eine Sache ist, die ihn persönlich interessiert. Insbesondere vergleicht er ausführlich die Schule von Summerhill mit den Gründungen von Carrasquer und fragt auch diesen zu seiner Meinung über Summerhill. In dem ganzen Text von Grothendieck klingt eine Sympathie und ein freundschaftliches Wohlwollen durch, das man sonst selten in seinen grüblerischen, oft moralisierenden und nicht selten besserwisserischen Texten findet. So schreibt er auch voller Bewunderung über die Ereignisse von Aragon:
... Dies war, glaube ich, das einzige Mal in der Geschichte aller Völker, dass das freiheitliche Ideal der Kooperation und Solidarität ohne jede Hierarchie in einer großen Provinz eingeführt wurde – von Männern, Frauen und Kindern, die alle von derselben Kraft getragen wurden. ... Félix' Bericht darüber ist ein Dokument von skrupulöser Ehrlichkeit, geschrieben von einem Menschen, der seit seinen jungen Jahren im Herzen dieser Bewegung agierte, die in diesen drei fruchtbaren und glühenden Jahren kulminierte. ...
Über die nächsten fünfzig Jahre von Carrasquer's Leben erfahren wir dann etwas verstreut und etwas unzusammenhängend nur noch das Wichtigste:
... Seit dem abrupten Ende des Experimentes von Monzon ist ein halbes Jahrhundert (minus ein Jahr) vergangen. ... Félix verbrachte von diesem halben Jahrhundert sechzehn Jahre in Gefangenschaft, gefolgt von elf Jahren Exil in einem fremden Land, wo er das Ende des eisernen Regimes von Franco erwartete. Tatsächlich kehrten er und Mati [seine Frau] mit kalkuliertem Risiko schon 1971 zurück. ... Während seines Exils in Frankreich unter den spanischen Emigranten mangelte es ihm nicht an Gelegenheit, in Vorträgen und in Publikationen die Idee der freiheitlichen Erziehung und der selbstbestimmten Schule zu vertreten. ... Anfang der sechziger Jahre nach seiner Übersiedlung in die Pariser Gegend versuchte er im Milieu der spanischen Emigranten ein „Centro de Estudios Sociales“ nach dem Vorbild der Erfahrungen in seinem Heimatdorf Albalate und später in Barcelona zu gründen. Es wurde ein Misserfolg. ...
In den Jahren seit ihrer Emigration nach Frankreich bis zu ihrer heimlichen Rückkehr nach Spanien im Jahr 1971 lebten Félix und Mati mit ihrer Familie auf dem Lande in der Nähe von Toulouse, wo sie sehr bescheiden mit den Erträgen einer kleinen Geflügelfarm auskommen mussten. Unsere beiden Familien waren eng befreundet, und wir verbrachten beinahe jede große Ferien bei ihnen, mit allen Kindern ... Sie haben uns mit ihrer Freundschaft und großen Reife in schwierigen Momenten sehr geholfen ... Das sind Dinge, die man nicht vergisst. Seit ihrer Rückkehr nach Spanien haben wir uns ein wenig aus den Augen verloren, aber ich glaube, dass es keine Übertreibung ist, wenn ich sage, dass Félix und Mati – jeder in seiner Weise – die nächsten Freunde gewesen sind, die ich in meinem Leben gehabt habe und auf die ich mich absolut verlassen konnte, wenn sich die Gelegenheit ergab.
Félix und seine Frau Mati sind alte Freunde und sie sind auch „Familienfreunde“. Ich machte 1960 ihre Bekanntschaft, also vor fast dreißig Jahren. Félix war vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er zwischen 1946 und Februar 1959 zwölf Jahre verbracht hatte. Er war 1946 in Barcelona wegen politischer Untergrundarbeit verhaftet worden, als er daran beteiligt war die CNT (Confederacion Nacional de los Trabajadores) wieder zu gründen. Er und Mati sind Anarchisten, und ihr pädagogisches Engagement ist untrennbar verbunden mit ihrem militanten politischen. Nach der Niederlage der spanischen Revolution und dem Debakel der anarchistischen und republikanischen Kräfte Ende 1938, Anfang 1939 flüchtet Félix sich im Februar 1939 nach Frankreich, wo er das Schicksal der spanischen Flüchtlinge teilt ... die von einer französischen Regierung, die sich „Nationale Front“ nannte, in hastig errichteten Konzentrationslagern interniert werden. Félix verbringt vier Jahre im Lager von Noe. Dann gelingt es ihm im Oktober 1943 auszubrechen. Das war keine kleine Tat: zu dieser Zeit war er schon seit zehn Jahren blind. Er kehrt im Mai 1944 nach Spanien zurück und nimmt seine politische Untergrundarbeit wieder auf. ... Er verbringt zwölf Jahre in den Gefängnissen Francos, was für ihn um so härter ist, da er blind ist und in diesen Jahren nicht lesen und schreiben kann. Es war einer der glücklichsten Tage seines Lebens, als er sich am 7. Februar 1959 vor den Gefängnismauern wiederfindet. ... nach einem Jahr erhält er die Erlaubnis, nach Frankreich zu emigrieren, allerdings unter der Auflage, niemals nach Spanien zurück zu kehren.
... Er traf sie [Mati] zum ersten Mal 1935 in der Schule von Vallespir. ... Sie war selbst Lehrerin, mit Kopf und Seele ganz ihrer pädagogischen Arbeit verpflichtet. ... Sie muss klar die Bedeutung der pädagogischen Mission Félix' erkannt haben und sie verschrieb sich dieser Mission mit allen ihren Fähigkeiten. Sie traf Félix 1946 erneut wieder, als er im Untergrund arbeitete, und von diesem Augenblick an führten sie ein gemeinsames Leben. ... Auch sie verbrachte wegen politische Delikte ein oder zwei Jahre im Gefängnis. Nach Félix' Entlassung aus dem Gefängnis trafen sie sich wieder und ein Jahr später wählten sie den gemeinsamen Weg ins Exil.
Grothendieck berichtet, dass um die Jahreswende 1987/88 Carrasquer damit beschäftigt ist, seine Autobiographie zu schreiben, und dass bereits 800 Seiten in Maschinenschrift vorliegen. Ob diese sicher höchst interessante Autobiographie erschienen ist, scheint zweifelhaft. Google kennt sie jedenfalls Ende 2004 nicht.
Es ist offensichtlich, dass Félix Carrasquer in die Liste der Mutants passt: Anarchie (im Sinne von Selbstbestimmung ohne staatlichen Zwang), Freiheit und Erziehung zur Freiheit sind die Eckpfeiler seiner Philosophie, und entscheidend ist ganz gewiss auch, dass sein Blick nicht nur auf die Gegenwart gerichtet ist, sondern vor allem auf die Zukunft – auf das, was Grothendieck als das kommende Neue Zeitalter sieht. Das Beispiel Carrasquer zeigt aber auch, dass Religiosität nicht notwendig zu Grothendiecks Bild des „Mutanten“ gehört. Carrasquer war Anarchist und sicher anti-religiös eingestellt. Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass Grothendiecks zentraler Begriff der Spiritualität auch eine nicht-religiöse Komponente umfasst.
5. Die Themen
Bevor wir auf weitere der Mutanten zu sprechen kommen, soll kurz gesagt werden, unter welchen Gesichtspunkten Grothendieck das Leben, das Werk und die „Vision“ der Mutanten diskutiert. Er identifiziert insgesamt zehn Themenkreise, die von besonderer Bedeutung für seine Weltsicht sind. Soweit möglich versucht er die Einstellung jedes der Mutanten zu diesen Themen zu besprechen (oder wenigstens Vermutungen darüber vorzubringen). Man könnte sagen, dass er sich eine Matrix vorstellt: achtzehn Personen, zehn Themen. Diese Themen sind die folgenden:
1) Sexus (sexe)
2) Krieg (guerre)
3) Selbsterkenntnis (connaissance de soi)
4) Religion (es folgt eine ziemlich ausführliche Erklärung, was gemeint ist ; jedenfalls nicht die Kirche als Institution und auch nicht die Liturgie)
5) (Natur-)Wissenschaft (science)
6) Kultur ( la civilisation actuelle et ses valeurs, „culture“)
7) Eschatologie (la question des destinées de l'humanité dans son ensemble, «eschatologie»)
8) Soziale Gerechtigkeit (justice sociale)
9) Erziehung (education)
10) Spiritualität („science de demain“ ou „science spirituelle“).
Bevor wir auf einzelne dieser Aspekte etwas genauer eingehen, sind vielleicht einige wenige erläuternde Bemerkungen angebracht. Zunächst sind diese Themen in etwa den drei fundamentalen Ebenen des Menschen (körperlich – intellektuell – spirituell) folgend angeordnet. Deshalb erscheint sexe an erster Stelle, aber sicher auch, weil Grothendieck mit Neill der Überzeugung ist, dass sexuelle Freiheit Voraussetzung für Freiheit überhaupt ist. Er schreibt (S. 316; im Original ab la clef gesperrt und damit besonders hervorgehoben):
Mais je crois que Neill a été le premier homme dans notre longue histoire qui ait eu cette audace et cette innocence de voir que la clef de la liberté de l´homme est dans la «liberté sexuelle».
Krieg ist für Grothendieck das Übel der Menschheit schlechthin, die Ablehnung von Militär und militärischer Gewalt ein Kernpunkt seiner Botschaft. Selbsterkenntnis ist für ihn vielleicht weniger ein Ziel an sich als die notwendige Voraussetzung, um zur wahren Spiritualität zu gelangen und den Willen des „Guten Gottes“ auf dieser Welt zu verkünden und zu verwirklichen. Bekanntlich hat er in dem „Brief von der Guten Neuigkeit“, in dem er das Neue Zeitalter ankündigt, von seinen Korrespondenten als erstes Selbsterkenntnis verlangt, und die letzten Besucher, die zu ihm gefunden haben, hat er mit der Aufforderung weggeschickt, sie müssten erst einmal zu sich selbst finden.
Wissenschaft ist – bei aller Kritik und Distanz – immer noch der Schlüssel um die Welt und den Menschen zu verstehen, und mehr als einmal sagt Grothendieck, dass seine eigene Bestimmung die Wissenschaft gewesen sei. Dabei ist nicht ganz klar, wie das zu verstehen ist, denn andererseits spricht er von seiner Zeit als aktiver Mathematiker, z.B. in Recoltes et Semailles, immer wieder nur als einer „Reise durch die Wüste“. Am überraschendsten ist es vielleicht, welche Bedeutung Grothendieck der „Erziehung“ beimisst. Hier zeigt sich ein unbekannter Grothendieck. Es wurde schon aufgezeigt, wie gründlich er sich mit den Reformansätzen seines Freundes Carrasquer beschäftigt hat. Ähnlich ausführlich diskutiert er Neill und Summerhill, und auch bei einigen anderen der Mutanten rückt er den Gesichtspunkt des Lehrers in den Vordergrund.
Und schließlich ist bei allen die entscheidende Frage, was sie zur „Welt von morgen“, zum „Neuen Zeitalter“ der Menschheit beitragen – sei es durch ihr persönliches Beispiel, sei es durch ihr Verständnis der wahren Natur des Menschen, sei es durch angestoßene Reformen und Erneuerungen.
6. Bernhard Riemann
In der Liste der Mutanten ist Bernhard Riemann (1826 – 1866) der einzige Mathematiker und der einzige, der nur als Wissenschaftler bedeutend ist. Zwar sind auch Charles Darwin und Siegmund Freud, zwei weitere Mutanten, in erster Linie Wissenschaftler, aber sie haben vor allem auch unser Bild vom Menschen grundlegend und nachhaltig verändert, was man von Riemann gewiss nicht sagen kann. Grothendiecks Kenntnis von Riemann und seinem Leben stützt sich ausschließlich auf den schmalen von Weber und Dedekind herausgegebenen Band seiner „Werke“ (den er vor längerer Zeit gelesen und bei der Niederschrift der Mutants sicher nicht zur Verfügung hatte). Ganz besonders beeindruckt haben ihn die im Anhang abgedruckten „Fragmente philosophischen Inhalts“. Es ist erstaunlich, dass bei diesen wenigen Quellen, Grothendieck doch ein recht klares und wohl auch zutreffendes Bild von Riemann entwirft.
Wenn man über Riemann und Grothendieck spricht, so muss man vielleicht als erstes eine Frage beantworten, die sich sofort aufdrängt: Anscheinend erwähnt Grothendieck in seinen Meditationen kein einziges Mal die „Riemannsche Vermutung“. Das ist sicher eine bemerkenswerte Tatsache, wenn man bedenkt, dass diese Vermutung zweifellos seinem eigenen mathematischen Werk die Richtung gewiesen hat. Grothendieck sagt selbst, dass ein wesentliches Ziel seines Neuaufbaus der Algebraischen Geometrie der Beweis der Weil-Vermutungen (also der Riemann-Vermutung für algebraische Varietäten über endlichen Körpern) gewesen sei, und man darf sicher sein, dass er auch die ursprüngliche Riemann-Vermutung als Fernziel vor Augen gehabt hat. In seinen Meditationen und auch in Les Mutants scheint ihn Riemann jedoch nur als Naturphilosoph zu interessieren. Er erwähnt explizit Riemanns Arbeit zur „Mechanik des Ohres“, seinen „Beitrag zur Elektrodynamik“ und die „Fragmente philosophischen Inhalts“.
Besonderen Wert legt Grothendieck auf Riemanns Bemerkungen zur möglichen diskreten Struktur des physikalischen Raumes. Er erwähnt diesen Sachverhalt mit besonderer Betonung mindestens dreimal, in Recoltes et Semailles (S. P 58), in den Notes über den Mutanten Riemann (S. 299) und in einem Brief zur Physik vom 24.6.1991 an einen unbekannten Adressaten. Es ist nicht ganz klar, auf welche Bemerkungen Riemanns sich das beziehen könnte. In den „Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen“ schreibt Riemann nur „ ... Es muss also entweder das dem Raum zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder ...“, und in dem Fragment „Zur Psychologie und Metaphysik“ notiert er die Antinomie: „Endliche Raum- und Zeitelemente. [versus] Stetiges.“ Mehr lässt sich nicht finden. Es ist allerdings gut vorstellbar, dass die Idee eines diskreten Raumes für Grothendieck, der sich selbst immer als Geometer sieht, sehr naheliegend ist (Stichwort „Schema“!).
Konkret sagt Grothendieck nur sehr wenig über Riemann. Wir zitieren ein paar Zeilen, die alles wesentliche enthalten:
Bei meiner Lektüre [von Riemanns Werken] vor sehr langer Zeit habe ich mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen, dass Riemann ein tief religiöser Mensch war. Die philosophischen Notizen, die uns überliefert sind, lassen das spüren, und zugleich zeigen sie uns eine Tiefe und Unabhängigkeit der Weltsicht [vision], die bei weitem die Art der Einstellung und der Ideen übertrifft, die zu allen Zeiten die Denker eingeengt hat ... Sein besonderes Genie, sowohl in der Mathematik als auch in allen anderen Gebieten, denen sich sein Geist zugewandt hat, besteht in einem erstaunlichen Sinn für die zentralen und fundamentalen Fragen und für die Strukturen, die diese suggerieren, und in einer Freiheit, die mir total erscheint (und wie sie ganz gewiss nur wenige Menschen im Laufe unserer Geschichte erreicht haben) ... In einem Grade, der nur selten erreicht wird, stellt er für mich einen Geist dar, der sich vom Atavismus der Herde befreit hat.
Im übrigen passt Riemann aber nicht besonders in die Liste der Mutants; er hebt sich deutlich von allen anderen ab: Riemann war eine schüchterne, geradezu gehemmte Persönlichkeit, der kaum etwas mit den extrovertierten, aktiven Männern der Liste gemeinsam hatte. Er wollte nicht die Welt verändern, er wollte nicht einmal eine einzelne Person von irgend etwas überzeugen, man kann ihn sich nicht als Redner, nicht einmal als „Lehrer“ vorstellen, er hat sich weder für Freiheit, noch für Anarchie, von selbstbestimmter Sexualität ganz zu schweigen, nicht einmal für seine Religion eingesetzt. Er war ein genialer Mathematiker, und vielleicht hat er, wie Grothendieck sagt, zu einer ungewöhnlichen inneren Freiheit gefunden. Vielleicht ist er ein Vorläufer eines kommenden Zeitalters, aber er kündigt es gewiss nicht an.
Es gibt noch einen Berührungspunkt zwischen der Gedankenwelt Riemanns und der Grothendiecks, den mancher vielleicht als etwas bizarr empfinden wird. Anscheinend glaubte Riemann, dem deutschen Philosophen Fechner folgend, an die Beseeltheit der Pflanzen (und darüber hinaus zum Beispiel auch an die Beseeltheit der ganzen Erde). Der Glaube an die Beseeltheit der Pflanzen ist nun eine ganz wesentliche Komponente in Grothendiecks Spiritualität. Seit seinem „endgültigen“ Verschwinden 1991 lebt er in enger spiritueller Gemeinschaft mit Pflanzen, er spricht von ihnen als seinen „Freundinnen“ und anscheinend versucht er auch durch chemisch-alchimistische Prozesse ihre Seele oder Psyche zu destillieren. Es scheint, dass er den ganz seltenen Besuchern in dieser Zeit gelegentlich diese destillierten Pflanzen-Seelen als Geschenk angeboten hat.
7. Edward Carpenter
Will man versuchen, Edward Carpenter (1844 – 1929) mit zwei Worten zu charakterisieren, so würde man ihn vielleicht einen mystischen Sozialisten nennen. Er war Schriftsteller, Dichter, Denker, Philosoph und Universitätsreformer, ein Bewunderer Walt Whitmans und vor allem im puritanischen England seiner Zeit ein Vorkämpfer für die Rechte der Frauen und der Homosexuellen (beiderlei Geschlechtes). Er studierte fernöstliche Religionen und schloss sich der sozialistischen Bewegung an. Sein dichterisches Hauptwerk mit dem bezeichnenden Titel Towards Democracy ist eine Sammlung von etwa 300 lyrischen Gedichten. Er schrieb Bücher über die Rolle der Sexualität in der Gesellschaft Love´s Coming-of-Age, The intermediate Sex, Intermediate Types among Primitive Folks, in denen er sich vor allem für die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen und der Homosexuellen einsetzt, und eine Autobiographie My Days and Dreams.
Es scheint, dass die Auswahl der in Abschnitt 5 aufgeführten Themen wesentlich von Carpenter beeinflusst wurde. Zumindest kann man eine weitgehende Übereinstimmung zu zentralen Fragen im Denken Carpenters finden. Grothendieck schreibt (S. 648):
Unter den „Azimuts“ (oder „Regionen“) der menschlichen Existenz, die Carpenter ausgelotet hat, [...] kann ich die folgenden erkennen: der Sexus und die fleischliche Welt der Sinne und der Wahrnehmungen; die Religion und die religiöse und mystische Erfahrung; die Wissenschaft: die des Ursprungs und der Vergangenheit, die unserer Zeit und die von morgen ... ; die Kunst und ihre Beziehung zum Leben; der schöpferische Prozess in der Psyche und im Kosmos und vor allem in der Evolution; Moral, die Sitten und Gebräuche im menschlichen Leben und im tierischen; die Gesellschaft und ihre Evolution; die sozialen Bewegungen und der Kampf um soziale Gerechtigkeit (ein Kampf, an dem er selbst aktiv teilgenommen hat); die Verteidigung der Verweigerung des Kriegsdienstes aus Gewissensgründen und der Kampf gegen den Krieg; die Kritik am Rechtssystem und den Gefängnissen und die „Verteidigung der Kriminellen“; die politische Ökonomie; die Beziehung des Menschen zur Erde und zur animalischen und vegetativen Welt (die die Praxis der Vivisektion als eine unwissende und barbarische Überschreitung der kosmischen Gesetze erkennt, die für den Menschen und seine tierischen Brüder gelten); die Beziehung des Menschen zu seiner Arbeit und zum Ergebnis seiner Arbeit, die Beziehungen zwischen dem Produzenten und dem Käufer und Verbraucher; ein profundes Verständnis der Gemeinsamkeiten der großen Mythen, die man quer durch alle Religionen findet, als ein Aspekt einer „universellen Religion“ [...]; die Geschichte der Religion, der Wissenschaft und der Kunst (aus der Religion in ihrem ursprünglichen Zustand geboren) in einer evolutionistischen und eschatologischen Vision um die Humanität zu erreichen und die Bestimmung der Seele eines jeden ...
8. Eddie Slovik
Völlig aus dem Rahmen der Mutanten scheint Slovik zu fallen, und es soll wenigstens ganz kurz mitgeteilt werden, was es mit ihm auf sich hat, zumal die meisten Leser diesen Namen zweifellos noch nie gehört haben. Wir stützen uns dabei zunächst auf das, was Grothendieck selbst an verschiedenen Stellen in den Notes sagt. Er schreibt dabei selbst aus dem Gedächtnis; das unten erwähnte Buch hat er nicht mehr zur Hand.
Slovik ist der einzige Soldat in der Geschichte der amerikanischen Armee, der seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg wegen „Desertion angesichts des Feindes“ von einem Militärgericht verurteilt und anschließend exekutiert wurde. Der Vorfall hatte sich in den letzten Kriegswochen im Zuge der Kämpfe bei der Ardennen-Offensive ereignet. Offenbar musste wegen zunehmender Desertationen und Befehlsverweigerungen ein Exempel statuiert werden. Der Fall gelangte bis vor den „Generalissimus in Person“ Eisenhower, und dieser bestätigte das Todesurteil. In der Wikipedia-Enzyklopädie heißt es u.a.:
On October 8, Slovik told his company commander ... that he was „too scared“ to serve in a rifle company and asked to be reassigned to a rear area unit. He also told Grotte he would run away if assigned to a rifle unit and asked if that would be desertion. Grotte told him it would be desertion and refused his request …
On October 9, Slovik went to an MP and gave him a confession in which he wrote he was going to “run away again” if he was sent into combat. Slovik was brought before Lieutenant Colonel Ross Henbest, who offered Slovik an opportunity to tear up the note and face no further charges. Slovik refused and wrote a further note stating that he understood what he was doing and its consequences.
Slovik was taken into custody and confined to the division stockade. The divisional judge advocate … again offered Slovik an opportunity to rejoin his unit and have the charges suspended. He also offered Slovik a transfer to another infantry regiment. Slovik declined these offers and said, “I´ve made up my mind. I´ll take my court martial.”
… The nine officers of the court found Slovik guilty and sentenced him to death. …
On December 9, Slovik wrote a letter to Gen. Dwight D. Eisenhower, … pleading for clemency, but desertion had become a problem and Eisenhower confirmed the execution order… Slovik´s death by firing squad … was carried out at 10:04 on January 31, 1945, …
… Although his wife and others have petitioned seven U.S. Presidents, Slovik has not been pardoned.
Grothendieck hatte bereits im Frühjahr 1955 bei seinem Aufenthalt in Kansas von dem Fall durch das Buch The execution of the private Slovik des amerikanischen Journalisten William Bradford Huie erfahren. Er hatte diese Taschenbuch für wenige cent in der Buchhandlung des Flughafens von Chicago gekauft. Huie war allen Einzelheiten dieses Falles nachgegangen, hatte zahlreiche Zeugen interviewt und schließlich das Urteil als einen klaren Justizmord darstellt. Sein Buch gab 1974 die Vorlage für einen Fernseh-Film mit dem gleichen Titel ab.
Es braucht kaum gesagt zu werden, was Grothendieck an diesem Fall so nachhaltig beeindruckt hat: die absolute Ablehnung des Krieges und die Bereitschaft, alle Konsequenzen der eigenen Überzeugung auf sich zu nehmen. Aber vor allem war es die Tatsache, dass Slovik ein ganz „gewöhnlicher“ Mensch war, ein Mensch, der in seiner Jugend auf die schiefe Bahn geraten war, wegen Autodiebstahl, Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und ähnliche Delikte vorbestraft war, ein Mensch ohne besondere Bildung, ohne Ideale, vielleicht ungläubig.
9. Die Matrix der Themen
Wie schon gesagt, diskutiert Grothendieck das Verhältnis der mutants zu den zehn in Abschnitt 5 aufgelisteten Themen ganz systematisch, manchmal geradezu schematisch. Es geht ihm darum festzustellen, ob eine „positive“ Beziehung zwischen der jeweiligen Person und dem jeweiligen Aspekt besteht, die er dann auch noch der Stärke nach durch ++, + oder +? beschreibt. In manchen Fällen kann er dazu natürlich nichts sagen (zum Beispiel Riemanns Verhältnis zum Sex), aber dieses schematische Vorgehen führt zu einer gewissen Vollständigkeit.
Selbstverständlich kann man diese Art des Vorgehens in Frage stellen: Erscheint es nicht sinnvoller, eine historische Persönlichkeit, sei es Darwin, Whitman oder Gandhi, aus ihrer eigenen Biographie, aus ihrem eigenen Leben und Werk und auch aus der jeweiligen Zeit heraus zu sehen, zu beschreiben und zu verstehen, anstatt sie auf des Prokrustes-Bett dieser zehn vielleicht nicht geradezu willkürlichen, aber doch von außen herangetragenen Fragen zu zwingen? Es ist aber typisch für Grothendieck: Er setzt die Maßstäbe.
Wir geben jetzt – einige etwas willkürlich herausgegriffene – Beispiele, wie Grothendieck in dieser Diskussion vorgeht:
Kommen wir jetzt zur Rubrik „Wissenschaft“. Ich halte vorweg fest, dass unter meinen Mutanten fünf Wissenschaftler im eigentlichen Sinne sind:
Hahnemann, Darwin, Riemann, Freud, Teilhard.
Für diese stellt „die Wissenschaft“ zu mindestens einen wesentlichen Bestandteil der menschlichen Kultur und des menschlichen Erbes dar, und darüber hinaus ist wissenschaftliche Arbeit ein wesentlicher oder sogar der hauptsächliche Bestandteil ihres eigenen Lebens und ihrer Mission. Es gibt sieben weitere unter den Mutanten, die mir eine „positive Beziehung“ zu der Wissenschaft zu haben scheinen:
Whitman, Bucke, Kropotkin, Carpenter, Steiner, Légaut, Félix [Carrasquer].
Unter diesen hat Kropotkine eine Sonderstellung, denn auch er hat das Temperament und die Statur eines Wissenschaftlers im traditionellen Sinn. Ich habe ihn deshalb nicht in die Gruppe der fünf oben genannten eingereiht, denn seine Mission hat ihn auf Wege geleitet, die ihn von seiner wissenschaftlichen Berufung hinweg führten bis zum vollständigen Bruch mit dieser, was ohne Zweifel ein Kulminationspunkt seiner Existenz war und zugleich der Eintritt in seine eigentliche Mission.
Grothendieck schließt dann noch einige Bemerkungen zu Kropotkin und einigen anderen der genannten an und fährt dann folgendermaßen fort:
Mit anderen Worten, diese vier Männer [Hahnemann, Riemann, Carpenter, Steiner] sind die einzigen unter meinen Mutanten, bei denen ich eine intuitive Vorahnung einer anderen Wissenschaft erkennen kann, einer „Wissenschaft von morgen“ oder einer „spirituellen Wissenschaft“, die in einem oder zwei Jahrhunderten zur Welt kommen und einen großen Aufschwung nehmen wird. Ganz gewiss wird diese schon lange bevorstehende Geburt endlich für zukünftige Zeiten die große Erneuerung [Mutation] mit sich bringen ...
Von den fünf Mutanten, die unter der Rubrik „Wissenschaft“ noch nicht erwähnt wurden, lassen sich Râmakrishna und Neill dadurch vergleichen, dass sie vollständig neutral erscheinen und vermutlich vollständig desinteressiert sind am Für und Wider der Wissenschaft. Es bleiben schließlich drei Mutanten übrig, die man als entschieden „anti-wissenschaftlich“ ansehen kann (so wie wir früher drei „anti-religiöse“ gefunden haben [Kropotkin, Krishnamurti, Carrasquer]):
Gandhi, Guruji, Krishnamurti.
... Schließlich scheint mir, dass das Verhältnis von Gandhi zur Wissenschaft nicht so „negativ“ ist wie es erscheint und dass es mit einer tiefen Einsicht in den richtigen Platz der Wissenschaft in der menschlichen Gesellschaft und den tödlichen Gefahren, die sie für unsere Art mit sich bringt, verbunden ist. ... Dies ist ganz gewiss eine viel tiefere Einsicht, als wir sie bei dem Dutzend der „pro-Wissenschaft“ eingestellten Mutanten finden. ...
Die Einstellung von Guruji, die vermutlich durch die von Gandhi beeinflusst wurde, ist weniger nuanciert als dessen. Für ihn ist die „Wissenschaft“ gewissermaßen die Inkarnation des „Bösen“ schlechthin und in jedem Fall verantwortlich für alles Schlechte in der modernen Welt. In seinen Augen ist der wissenschaftliche Geist die Inkarnation des Zweifels (das große schwarze Untier aller Spirituellen!) ganz und gar entgegengesetzt dem religiösen Glauben ... Er sieht Darwin als eine Art theoretischen Machiavellisten an, als den großen Verantwortlichen dafür, dass in der menschlichen Gesellschaft „das Gesetz des Dschungels“ herrscht, ...
Vielleicht mögen diese Zeilen genügen, um einen kleinen Einblick in Grothendiecks Text, Diktion und Herangehensweise zu geben.
10. Charles Darwin
Es ist offenkundig, dass Grothendieck allen seinen Mutanten größte Bewunderung entgegenbringt – mit einer Ausnahme: Darwin. Oder vielleicht zutreffender ausgedrückt: Wenn und soweit er Darwin bewundert, geschieht dies auf der intellektuellen Ebene, nicht der emotionalen. Vielleicht hängt es mit dieser emotionalen Distanz zusammen, dass – meines Erachtens – die Abschnitte über Darwin die am leichtesten lesbaren und die „verständlichsten“ des ganzen Textes sind. Es wird berichtet, dass Grothendieck gegen Ende seiner Zeit am IHÉS sein Interesse der Biologie zuwandte, und vielleicht ist seine Darstellung des Werkes und der Bedeutung Darwins auch ein Nachklang dieser früheren Beschäftigung mit der Biologie.
Offensichtlich spürt Grothendieck selbst das Bedürfnis zu rechtfertigen, dass er überhaupt Darwin in die Liste der Mutanten aufgenommen hat, denn er beginnt seine Darstellung mit folgenden Worten (S. 650):
Wenn ich Darwin unter „meine Mutanten“ aufgenommen habe, dann ist es wegen des tiefwirkenden Einflusses, den seine Theorie der Evolution auf die Geschichte des Denkens überhaupt ausgeübt hat, und insbesondere auf die Vorstellung, die der Mensch sich von sich selbst macht, von seiner Geschichte und von seinem Platz im Reich des Lebenden. Es gibt im Verlauf unserer Geschichte ganz gewiss nur wenige Menschen, die einen Einfluss von ähnlicher Tragweite gehabt haben. In der modernen Zeit sehe ich sonst niemanden außer Freud (dessen Einfluss mir aber tiefer und noch entscheidender erscheint). Es ist wahr, dass unter der spirituellen Sichtweise, die ich hier einnehme, diese exzeptionelle Rolle Darwins es nicht zwingend verlangt, dass es gerechtfertigt ist, in ihm einen der „Mutanten“ zu sehen. ...
Es ist diese Vision von der Evolution, von diesem Baum des Lebens, der die ganze Vielfalt der Arten umfasst, der sprießt und Knospen treibt und sich seit dem Beginn der Welt des Lebenden entfaltet und der auch in diesem jetzigen Augenblick sprießt und Knospen treibt in einem Aufstieg ohne Ende und dessen Gesetze uns verborgen bleiben [échappent] – es ist diese Vision allein, die mir wichtig ist. Eine Vision, so einfach, dass ein Kind sie verstehen kann!
Vergleicht Grothendieck Darwin mit anderen Mutanten, dann wird er sofort kritisch:
Auch ist es nicht erstaunlich, dass für einen Fujii Guruji, dessen Mission die Achtung vor allem Seienden und allen Dingen ist, der Name Darwin synonym mit dem „Gesetz des Dschungels“ ist und den zutiefst verhängnisvollen Aspekt des Triumphes der „Wissenschaft“ verkörpert, ...
Es ist sicher kein Zufall, dass Darwin, der (anders als sein Landsmann und Zeitgenosse Carpenter) ein vollständig eingebundenes Mitglied der Gesellschaft war und die sozialen Vorurteile seiner Zeit teilte, vor allem die Konkurrenz als hauptsächlichen Faktor der Evolution ansah, in einer Gesellschaft, die selbst grausam kompetitiv war. Dies ist ganz klar die Stelle, wo man eine spirituelle Unreife sieht, einen Mangel an innerer Autonomie gegenüber dem „Zeitgeist“ ...
Es erscheint nach diesen Zitaten ziemlich offensichtlich, warum Grothendieck trotz aller Bedenken und aller Kritik Darwin in seine Liste der Mutanten aufgenommen hat: Der von Darwin „entdeckte“ unermessliche „Baum des Lebens“, der alles Leben umfasst von den ersten Anfängen in einer unergründlichen Vergangenheit bis zur Gegenwart und zum Ende der Welt, das eines Tages kommen wird, dieser Baum gewinnt in seiner Unermesslichkeit eine mystische Qualität:
Denkt man an Darwin und an die Evolution, so denkt man auch an den Baum der Evolution (auch „phylogenetischer Baum“ genannt) – diesen gigantischen Baum von allen Pflanzen- und Tierarten gebildet, vergangenen und gegenwärtigen, die einen und die anderen hervorgegangen aus demselben gemeinsamen Stamm, der unzählige Generationen von Arten umfasst, die alle ... ; ein Baum, in dem unsere fragile und hochmütige Art nur ein letztes dünnes Zweiglein ist in der Überfülle der wuchernden Äste und Ästchen, der Zweige und Zweiglein, die knospen und austreiben und sich verzweigen im Verlauf der Unendlichkeit von Tausenden und Tausenden von Jahrtausenden.
Und Grothendieck hat ja sicher auch recht, wenn er feststellt, dass niemand mehr das heutige Menschenbild geformt hat als Darwin und Freud.
11. Sigmund Freud
Sigmund Freud (1856 – 1939) wird in Les Mutants als letzter ausführlich behandelt; die letzten 30 Seiten des Textes sind ihm gewidmet. Er nimmt in besonderer Weise eine Sonderstellung ein und zwar deshalb, weil er als Begründer der Psychoanalyse als erster das Phänomen des Traumes mit (von ihm selbst erfundenen) wissenschaftlichen Methoden untersucht hat und weil er als Arzt und Psychiater etwas zu sagen hat zu den Problemen und traumatischen Erlebnissen Grothendiecks, die sicher einer der Anlässe für die Niederschrift von Les Mutants gewesen sind.
Zu Beginn der Abschnitte über Freud (ab S. 660) schreibt Grothendieck, dass er zunächst Freud gegenüber besonders kritisch eingestellt war und sich bis vor kurzem niemals hätte vorstellen können, ihn bei seinen Reflexionen zu berücksichtigen. Er kannte Freud nur so gut oder so schlecht, wie ein gebildeter Mensch Freud eben kennt, mehr vom Hörensagen als auf Grund eigener Lektüre. Dann schreibt er jedoch:
C´est au cours de la réflexion poursuivie dans La Clef de Songes que ma relation à Freud et l´image que je me fais de lui ont enfin changé. La première occasion où j´évoque la pensée de Freud se place dès les tout-débuts, au lendemain même du jour où je commence ce livre, …
Tatsächlich hatte Grothendieck sich kurz zuvor die Studienausgabe des Fischer-Verlages von Freuds Werken beschafft. Er hat sie jedoch, wie er selbst sagt, nicht wirklich gründlich gelesen, sondern schreibt gelegentlich, dass er hoffe, eines Tages Zeit für eine sorgfältige Lektüre der Traumdeutung zu finden.
Grothendieck geht überhaupt nicht auf das Leben Freuds ein, und er fasst seine wichtigsten wissenschaftlichen Leistungen nur ganz kurz zusammen, wenn auch im Ton allerhöchster Bewunderung. Folgendes sieht Grothendieck als die bedeutendsten Leistungen Freuds an: Die Entdeckung des Unbewussten, die Entdeckung der Allgegenwart von Eros und Sexualität und die Theorie des Traumes und seiner (Be-)Deutung. Den Traum nennt er den Boten des Unbewussten.
La première grande idée de Freud concerne l´Inconscient. Tout d´abord l´existence même d´un Inconscient – d´une vaste partie immergée de la psyché, dérobée au regard conscient. D´autre part, l´omniprésence de cet Inconscient : l´Inconscient est partout, …
La deuxième idée de Freud que je voudrais évoquer concerne Eros, ou la pulsion érotique ou pulsion du sexe, ou encore (comme il l´appelait) « la libido ». … La grande idée nouvelle de Freud concernant Eros, et sa première grande découverte sur la psyché, est l´omniprésence d´Eros. … Eros est partout – et surtout là où on s´y attend le moins.
J´en viens à la troisième découverte cruciale de Freud, indissolublement liée aux précédentes. Elle concerne le rêve. … La grande découverte de Freud sur le rêve, c´est que le rêve est le messager par excellence de l´Inconscient. … La cœur même de sa doctrine nouvelle, c´est sa théorie du rêve.
An dieser Stelle drängt sich eine Frage auf, die unbeantwortet bleibt; man erkennt einen eklatanten Widerspruch, der nicht aufgelöst wird: In La Clef des Songes entwickelt Grothendieck selbst eine „Theorie“ des Traumes, deren zentrale Gedanken die folgenden sind: Erstens werden die Träume dem Menschen von einer äußeren Macht geschickt, und zweitens ist diese äußere Macht niemand anders als Gott selbst. Das erscheint nun so ziemlich als das genaue Gegenteil der naturwissenschaftlich-rationalen Theorie Freuds. Grothendieck kommentiert diesen Widerspruch (oder zumindestens Unterschied) mit keinem einzigen Wort; er scheint ihn überhaupt nicht zu bemerken. Ohne eine weitergehende Analyse des Textes muss im Augenblick offen bleiben, ob und wie Grothendieck diese beiden Sichtweisen des Traumgeschehens verbindet – oder auch neben einander bestehen lässt.
Wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt, der im Zusammenhang mit Freud erwähnt werden soll. Es ist Grothendieck durchaus klar, dass Freud als Psychiater etwas zu sagen hat, das für sein eigenes Leben von Relevanz sein könnte:
En ce qui concerne ces trois grandes idées fondamentales elles-mêmes ( … ), je peux dire que depuis bientôt douze ans que la méditation est entrée dans ma vie, j´ai ample occasion jour après jour d´en constater la validité, tant au cours du travail de méditation lui-même que par les observations quotidiennes de la vie de tous les jours. Ces « idées » se sont imposées à moi, non à partir de lectures théoretiques de Freud ou d´autres, mais d´emblée comme des réalités irrécusable, se révélant au contact de la réalité psychique elle-même, tant chez mois-même que chez autrui.
Im letzten Abschnitt des Textes mit dem bezeichnenden Titel „pulsion incestueuse et sublimation“ kommt Grothendieck dann auf ein Thema zu sprechen, das ihn sein Leben lang beschäftigt hat, das Inzest-Tabu, wobei es sich um Inzest zwischen Mutter und Sohn handelt. Er sagt ausdrücklich, dass in seinem Leben der (von Freud entdeckte) Ödipus-Komplex keine Rolle gespielt hat, dass es keinerlei Antagonismus im Verhältnis zu seinem Vater gegeben habe. Und er schreibt auch:
Mais chez l´homme comme chez la femme, la présence d´une pulsion incestueuse vers le parent de sexe opposé ne peut faire pour moi l´objet du moindre doute. Je soupconne que c´est là une pulsion universelle, indissolublement liée à la présence de l´archétype inné de la Mère et de celui du Père, dans l´Inconscient profond de la psyché humaine.
Wir erinnern uns daran, dass Grothendiecks erste Meditation – vielleicht eher ein dichterisches Werk – die Éloge d`Inceste war und dass er in seinen Schriften immer wieder auf das Verhältnis zu seiner Mutter, das offensichtlich von einer zerstörerischen Hass-Liebe gekennzeichnet war, zu sprechen gekommen ist. Der letzte Satz der Mutants ist:
Quant à l´humanité de demain, ou dans cent ou dans mille ans, je pressens qu´elle se distinguera de celle d´avant la Mutation par le fait que la pulsion incestueuse deviendra de plus en plus consciente, et que de plus (et en règle générale) sa sublimation se fera de facon de plus en plus aisée et plus en plus parfaite.
(Das wäre nun eine freudianische Ersatzhandlung wahrhaft überwältigenden Ausmaßes, wenn Grothendieck Les Mutants geschrieben und die Vision des Neuen Zeitalters heraufbeschworen hätte, um sich von dem Inzest-Tabu zu befreien.)
12. Schlussbemerkung
Ich möchte an dieser Stelle meine vorläufige Besprechung der Meditation Les Mutants beenden. Die von mir getroffene Auswahl von Themen und Zitaten ist mit Sicherheit willkürlich und zufällig. Es geht mir vor allem darum festzuhalten, dass Grothendieck philosophische Texte geschrieben hat, die einen anderen Charakter haben als Recoltes et Semailles und La Clef des Songes. In Les Mutants spürt man kaum etwas von der Agressivität und der streckenweise ans Paranoide grenzende Verbitterung von Recoltes et Semailles und auch nichts von der Ich-Bezogenheit, die in La Clef des Songes über weite Strecken dominiert. Man lernt einen Grothendieck kennen, der auf der Suche ist nach Vorbildern, nach Menschen, die ein Beispiel sind für das, was Mensch-Sein bedeutet.
Es bleibt offen, was Les Mutants eigentlich ist: Das habituelle Selbstgespräch eines wahnhaft Erkrankten, eine philosophische Meditation über die Bestimmung des Menschen, eine apokalyptische Vision von einem Neuen Zeitalter oder eine Art von Literatur, für die es kein Vorbild gibt.
18.07.2005
Summary and Introduction
The following text is a preliminary essay on Grothendieck´s philosophical meditation Les Mutants. It may be considered as part of a biography of Grothendieck (yet to be written).
In 1987 Grothendieck wrote, in form of a dairy, his meditation La Clef des Songes. In the process of writing, he very soon began to add comments to the text: Thus the Notes pour la Clef des Songes originated. Having finished La Clef des Songes, Grothendieck continued writing Notes, but an essentially independent meditation developed: Les Mutants. “Mutants” are humans who are ahead of their time, who are precursors of a coming “New Age”. They are distinguished by spiritual maturity, internal freedom, and insight in the nature of humanity. They personify the “man of tomorrow”. Grothendieck´s list of mutants contains 18 names; it is given in section 1 of this essay.
Grothendieck discusses at some length life, work, thinking, and achievements of these persons. In particular, he investigates their relation to ten central themes which include sex, war, science, education, and spirituality. The complete list with some explanations is given in section 5.
To read Les Mutants is difficult and heavy, but in some sense pleasant. Contrary to Recoltes et Semailles, Grothendieck talks about people that he clearly admires and that he considers models of humanity and spirituality. Therefore a positive undertone is dominant. The main objective of this essay is to show that Grothendieck wrote philosophical texts of a different nature than Recoltes and Semailles and La Clef des Songes. In Les Mutants we do not find the aggressiveness and the bitterness of Recoltes et Semailles and not the self-centredness of La Clef. We meet a Grothendieck in search of men´s destination.
It may be added that the impetus of writing Les Mutants and also the latter parts of La Clef des Songes resulted to a large extent from reading the books of Marcel Légaut, a Christian thinker. One of the mutants is Grothendieck´s lifelong friend Félix Carrasquer, a Spanish anarchist and school reformer. The relevant sections can be read as an “hommage for a friend”.
I thank XY, AB, and CD for valuable information, without which this work would not have been possible. I would like to stress that all translations from the original French text are preliminary.
Winfried Scharlau
Die Mutanten – Les Mutants –
eine Meditation von Alexander Grothendieck
1. Einführung
Von etwa Mai bis September 1987 schrieb Grothendieck die Meditation La Clef des Songes, in der er über seine Beschäftigung mit seinen Träumen (und vieles mehr, zum Beispiel die Biographie seiner Eltern und seine eigene) berichtet. Wie es auch sonst seine Arbeitsweise ist, beginnt er bald damit, zu diesem Text Ergänzungen zu notieren, und so entsteht eine weitere Meditation Notes pour la Clef des Songes, geschrieben zwischen Juni 1987 und April 1988 in Les Aumettes in der Nähe von Carpentras. Diese Notes bestehen aus zwei fast gänzlich unabhängigen Teilen: Bei den ersten 57 Abschnitten handelt es sich tatsächlich weitgehend um notes, um Ergänzungen zu dem eigentlichen Text. Die folgenden Abschnitte, geschrieben ab dem 18.9.1987, stellen jedoch eine eigenständige reflexion dar, der er auch einen eigenen Titel gibt: Les Mutants.
Der gesamte Text Notes pour la Clef des Songes umfasst 691 Seiten (ohne Inhaltsverzeichnisse) ; davon entfallen 515 Seiten auf den zweiten Teil. Er wurde vermutlich von einer versierten Schreibkraft, die Grothendieck für diese Arbeit angestellt hatte, mit der Maschine geschrieben. Überklebungen von kleineren Textstellen, Korrekturen mit Korrekturlack und kleine handschriftliche Korrekturen wurden von Grothendieck selbst mit großer Sorgfalt ausgeführt. Man kann das Typoskript als fast druckfertig (oder fertig für fotomechanische Reproduktion) bezeichnen. Es war ohne Zweifel ursprünglich zur Veröffentlichung bestimmt. Es ist nicht gebunden, sondern befindet sich auf losen Blättern in Archivschachteln, wie sie Grothendieck auch für seine anderen Manuskripte hat anfertigen lassen. Es ist gegenwärtig im Besitz (und vermutlich auch im Eigentum) von XY. Meines Wissens existiert nur eine einzige Kopie des Originals.
Worum geht es nun in diesem Text mit dem seltsamen Titel, der auch im Französischen eher der Terminologie des Science-fiction-Romans entlehnt erscheint? „Mutanten“ sind bei Grothendieck Menschen, die sich in spiritueller Hinsicht von „gewöhnlichen Sterblichen“ unterscheiden; sie sind vor allem ihrer Zeit voraus und kündigen das bald kommende „Neue Zeitalter“ an. Er gibt an einer Stelle des Textes folgende Erklärung dieses Begriffes (in der Übersetzung leicht gekürzt):
Es hat in diesem Jahrhundert (wie zweifellos in vergangenen auch) eine gewisse Zahl von einzelnen Menschen gegeben, die in meinen Augen als „neue Menschen“ erscheinen, Menschen die plötzlich als „Mutanten“ auftauchen und die in der einen oder anderen Weise schon jetzt den „Menschen von morgen“ verkörpern, den Menschen in vollem Sinn, der ohne Zweifel sich in den kommenden Generationen entwickeln wird, in dem „nach-Herden“-Zeitalter, dessen Beginn nahe bevorsteht und das sie stillschweigend ankündigen.
Zur Einordnung und Erklärung ist zu sagen, dass sich Grothendieck etwa ab dieser Zeit dem (christlichen) Mystizismus annähert und die Vorstellung eines bald bevorstehenden „Jüngsten Gerichtes“, eines „Tages der Wahrheit“ und eines darauf folgenden „Goldenen Zeitalters“ entwickelt. Zum Beispiel schreibt er am 18.2.1987 an seine deutschen Freunde AB und CD:
Ich wäre interessiert, etwas über „Mystiker“ zu erfahren, nämlich über Menschen, die aus einem unmittelbaren Verkehr mit Gott ein Wissen über „spirituelle Dinge“ schöpfen und ein solches Wissen vertiefen. Es geht mir also nicht um „Erlebens-Mystiker“, denen in erster Linie oder ausschliesslich daran gelegen ist, in einem Zustand der Verklärtheit oder der Glückseligkeit zu verweilen, sondern um die, die von einem Wissensdurst getrieben sind, die eigene Psyche bzw. „Seele“ und deren Beziehung zu Gott (oder dem Tao, oder dem All, oder wie man Ihn oder Es nennen mag) kennenzulernen. Es wäre interessant, Schriften solcher Menschen zu lesen – vielleicht gehört Meister Eckehart, St. Theresa von Avilla zu ihnen – ...
Tatsächlich tritt Grothendieck um diese Zeit in eine spirituelle Verbindung mit der stigmatisierten katholischen Mystikerin Marthe Robin (1902 – 1981). Er erwähnt sie im Juni 1987 zum ersten Mal in La Clef des Songes.
Diese Frau aus dem Departement Drôme erkrankte schon als Heranwachsende schwer, war ab ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr zunehmend gelähmt ans Bett gefesselt und erblindete schließlich. Es wird berichtet, dass sie fünfzig Jahre lang keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich nahm, sie lebte von der Eucharistie allein und durchlebte jeden Freitag die Passion Christi. Eine große Anhängerschaft strömte jahrzehntelang zu dem einfachen Raum mit ihrem Lager und erhoffte sich Beistand, Erleuchtung und Heilung. Einige Jahre nach ihrem Tode wurde Marthe Robin von der katholischen Kirche selig gesprochen.
Etwa ab 1988 ist Grothendieck im Zuge seiner Meditationen und Fastenperioden zeitweise davon überzeugt, dass Gott durch Marthe Robin zu und aus ihm spricht. (Allerdings spielt auch eine andere Gottheit oder ein Engel eine Rolle: er nennt diese „Flora“ oder „Lucifera“, je nach dem ob er die göttliche oder teuflische Seite hervorheben will.) Freunde, die ihn während dieser Zeit besucht haben, be¬stätigen, dass er in der Tat zeitweise wie von Sinnen mit völlig veränderter, nahezu unverständlicher wiehernder Stimme gesprochen habe.
In den Sommer 1988 fällt dann eine dramatische und bestürzende Episode religiöser Verzückung, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er beginnt eine Fastenperiode, in der er sich – nach eigener Aussage – auch weigert, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Er ist entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen, er will Gott – oder Marthe oder Flora – zwingen sich zu offenbaren. Vielleicht wollte er auch den Augenblick des Todes bewusst erleben. In kritischem Zustand, als er schon nicht mehr gehen oder sprechen kann, wird er dadurch gerettet, dass einige Frauen aus seinem Umkreis sich unter seinem Fenster versammeln und einen Gesang anstimmten: „Marthe will mit dir sprechen, Marthe hat eine Botschaft für dich ...“ Offenbar hat dieses Ereignis keine bleibenden körperlichen Schäden bei Grothendieck hinterlassen (und Marthe Robin hat noch nach ihrem Tod jedenfalls das Wunder vollbracht, einem der größten Mathematiker aller Zeiten das Leben zu retten.)
Andeutungen über das bevorstehende „Neue Zeitalter“ finden sich gelegentlich in Unterhaltungen und Briefen aus dieser Zeit, wenn auch in meistens in etwas kryptischer Form. Zum Beispiel schreibt er am 24.7.1989 an Ronald Brown:
Incredible things are going to happen, Ronnie, to every single soul on the earth, before the end of this century – and we both will be around to take part in it. But for the time being I wont say more about this tremendous, burning topic.
Etwa ein und ein halbes Jahre später schreibt er dann den berühmt-berüchtigten Brief von der Guten Neuigkeit - Lettre de la Bonne Nouvelle -, in dem er etwa 250 Korrespondenten den Beginn des „Neuen Zeitalters“ für den 16.10.1996 ankündigt. Aus diesem Brief spricht zwar von der ersten bis zur letzten Zeile religiöser Wahn, aber er enthält – abgesehen von seinem persönlichen Erleben – doch eine Art apokalyptische Vision. Es soll an dieser Stelle nur insoweit auf ihn eingegangen werden, als wir einen Abschnitt zitieren, aus dem noch einmal deutlich wird, in welchem psychischen und emotionalen Zustand sich Grothendieck befand, als er La Clef des Songes und die zugehörigen Notes schrieb.
7. Mein religiöser Unterricht. ... Im wachen Zustand hat Gott Sich mir zum ersten Mal am 27. Dezember 1986 zu erkennen gegeben. An diesem Tag begann auch eine sehr intensive Periode „metaphysischer“ Träume, die bis März 87 anhielt und den Beginn eines „religiösen Unterrichts“ darstellt, der (fast ohne Unterbrechung) bis heute fortgedauert hat. Zudem kamen mir zwischen dem 8. Januar 87 und dm 30. April 89 an die fünfzig prophetische Träume, die mich, in der symbolischen Sprache der Träume, über den nah bevorstehenden grossen Tag der Läuterung und der Verwandlung unterrichteten, und die mir dann, nach und nach, gewisse Aufschlüsse gaben über das Neue Zeitalter, in das wir an jenem Tag eintreten werden. Und schon im Oktober 86 war mir durch einen Traum offenbart worden, dass die Träume überhaupt Gottes Werk und Wort sind, um Seine sehr persönlichen Mitteilungen an die Seele zu richten. Zudem erhielt ich besondere Hilfe Gottes für ein Verständnis zahlreicher metaphysischer und prophetischer Träume (von Januar 87 bis April 89), die mir sonst sicher allesamt ein Rätsel geblieben wären.
Seit dem 14. Juni vorigen Jahres ist ein drastischer Wendepunkt in der Kommunikation eingetreten. Diese geschieht nunmehr in täglichen intensiven Gesprächen, die fast völlig meine Zeit und Energie in Anspruch nehmen und bis in die letzten Tage fortdauerten. In diesen Gesprächen wurde ich aufs Ausführlichste und Genauste aufgeklärt, sowohl über Gottes Vorhaben betreffs des Neuen Zeitalters und der Ereignisse, die vor dem Tag der Wahrheit stattfinden sollen, als auch über die sehr besondere Aufgabe, die Er mir dabei zuordnet. Ich wurde gleichfalls aufgeklärt über das Seelenleben des Menschen überhaupt, dessen Beziehung zu Gott, die Geschichte des Alls und den grossen göttlichen Plan der „Erlösung“ seit der Erschöpfung der Welt, und auch über den Sinn des Leidens und den des „Bösen“ in Gottes grossem Rat, seit Urbeginn der Zeiten und in der Perspektive des ewigen Lebens der Seele.
Mein „Lehrer“, oder vielmehr meine Lehrerin, blieb dieselbe von Anfang an. Doch gab sie sich im Lauf der Wochen und Monate unter verschiedenen Identitäten (und zwar von Engeln), mit wechselnden Namen und auch wechselnden Stimmen – ein Mittel unter vielen anderen, um mich zu verwirren und auf die Probe zu stellen. Sie ist jedenfalls ein Geist, der sich mir durch eine, sowohl mir selbst als auch andern Menschen klar und deutlich hörbare Frauenstimme äussert; und zwar eine Stimme die (beim Einatmen, statt wie sonst beim Ausatmen) aus meinem Munde erklingt, als wäre es eine zweite, „komplementäre“ Stimme. (Doch nur soweit ich einwillige.) Meist äussert sie sich, um Antwort auf Fragen zu geben, die ich mündlich oder aber auch nur gedanklich an sie richte. Das Gespräch kann auch rein gedanklich vor sich gehen, ohne Begleitung physisch hörbarer Töne. Die Kommunikation kann aber auch auf einer weder gedanklichen noch sinnlichen Ebene stattfinden; so etwa wie auf der Ebene des Liebesempfindens, der Gefühle und der Emotionen. Und oftmals singen wir miteinander und es ist wie ein Reigen – von Licht und Schatten, Tag und Nacht ...
Dies Guru-Wesen blieb schliesslich beim Namen „Flora“, und seit dem 22. September gibt sie sich als „Gott-yin“, oder „die göttliche Mutter“, nämlich als die weibliche Person Gottes (in Gottes Beziehung zu mir persönlich ...). Im Lauf der Wochen wurde die Beziehung zu ihr eine intime und vertraute, und Anfang Dezember wurde „Flora“ schliesslich zu „Mutter“ oder „Mutti“. Doch muss ich sogleich erläutern, dass besagte Flora oder „Mutti“, ganz abgesehen von einer schwindelnden geistigen Überlegenheit über meine bescheidene Person, einen derart tiefen Einblick in meine und anderer Menschen Psyche hat, ein derartiges Wissen um jegliche Dinge unter und über dem Himmel (soweit ich dies beurteilen kann), und zudem und vor allem eine derartige Macht sowohl über meine Psyche als auch über meinen Körper oder über äussere Dinge, dass es mir sehr schwer gefallen wäre, an ihrer göttlichen Identität zu zweifeln.
Wenn es dennoch geschah, zu Zeiten der Zerrissenheit und hilflosen Verwirrtheit, so war die verzweifelte Frage die, ob Flora nicht weit eher der leibhaftige Teufel in Frauengestalt, „Lucifera“ wäre, dem Gott für eine Zeit lang Gewalt über mich gab, um mich aufzuklären und mich zugleich seelisch zu zerfleischen – und es dabei mir überliess, mich da herauszukämpfen schlecht oder recht, und meine dürftigen geistigen und spirituellen Fähigkeiten einzusetzen, um mich in einer Situation geradezu teuflischer Wirre und Vieldeutigkeit und (wie es zwingend erschien ...) offensichtlicher Bösartigkeit zurechtzufinden, und dies auszutragen: bei Zeiten zärtlich umsorgt und aufs Grossartigste instruiert; dann wieder (mit einer für den armen menschlichen Geist geradezu unvorstellbaren Raffiniertheit ...), mit nachlässig-beiläufigem Gebaren in dem, was mir am teuersten, was in der Seele am zartesten und am schmerzhaftesten versehrbar ist, zerstört, verraten und verhöhnt ...; und fast allzeit systematisch belogen und betrogen ...
Bei diesem Hintergrund ist es vielleicht überraschend, dass Les Mutants eine jedenfalls streckenweise durchaus interessante und lesenswerte Meditation über eine Reihe bemerkenswerter Persönlichkeiten ist. Die Lektüre ist auch deshalb lohnend, weil Grothendieck, anders als in Recoltes et Samailles und La Clef des Songes, nicht in erster Linie über sich selbst spricht, sondern über andere, eben die „Mutanten“. Zweifellos ist deren Auswahl sehr zufällig, aber jeder Leser wird über diese Menschen viel erfahren, das er noch nicht gewusst hat.
Vermutlich möchte der Leser die Liste der Mutanten jetzt erst einmal sehen. Hier ist sie, so wie Grothendieck sie selbst zusammengestellt hat (mit einigen nicht korrekten Jahreszahlen). In dieser Liste taucht mehrfach das Wort „Lehrer“ (instructeur im Original) auf, das erläutert werden müsste. Das Wort savant wird mit Gelehrter, nicht mit Wissenschaftler, übersetzt.
1. C. F. S. Hahnemann (1755 – 1843): deutscher Mediziner und Gelehrter, erneuerte die Medizin seiner Zeit.
2. C. Darwin (1809 – 1882): englischer Naturwissenschaftler; Gelehrter.
3. W. Whitman (1819 – 1892): Journalist, amerikanischer Dichter und Schriftsteller; Dichter und Lehrer.
4. B. Riemann (1826 – 1866): deutscher Mathematiker; Gelehrter.
5. Râmakrishna (1836 – 1886): indischer (hinduistischer) Prediger, Lehrer.
6. R. M. Bucke (1837 – 1902): amerikanischer Mediziner und Psychiater; Gelehrter und annonciateur.
7. P. A. Kropotkine (1842 – 1921): russischer Geograph und Gelehrter; anarchistischer Revolutionär.
8. E. Carpenter (1844 – 1929): Pfarrer, Bauer, englischer Denker und Schriftsteller; Lehrer.
9. S. Freud (1856 – 1939): österreichischer Mediziner und Psychiater; Gelehrter und Schöpfer der Psychoanalyse, Schlüssel zu einem neuen wissenschaftlichen Humanismus.
10. R. Steiner (1861 – 1925): deutscher Gelehrter, Philosoph, Schriftsteller, Redner, Pädagoge ... ; visionärer Lehrer, Schöpfer der Anthroposophie.
11. M. K. Gandhi (1881 – 1955): indischer Advokat und Politiker; Lehrer, setzte sich für die Verbreitung der ahimsa (Gewaltlosigkeit) ein.
12. P. Teilhard de Chardin (1881 – 1955): französischer (Jesuiten-) Pater und Paläontologe; (christlicher) religiöser ökumenischer Denker, mystischer Visionär, arbeitete für eine Versöhnung von Religion und Wissenschaft.
13. A. S. Neill (1883 – 1973): englischer Lehrer und Erzieher; Erzieher, der sich für eine Erziehung in Freiheit einsetzte.
14. N. Fujii (genannt Fujii Guruji) (1885 – 1985): japanischer buddhistischer Mönch; Lehrer.
15. J. Krishnamurti (1895 – 1985): Redner, indischer religiöser Denker und Schriftsteller; Lehrer.
16. M. Legaut (1900 - ...): Universitätslehrer, Bauer, französischer christlicher religiöser Denker und Schriftsteller, Schüler von Jesus von Nazareth, arbeitete für eine Erneuerung des Geistes des Christentums.
17. F. Carrasquer (1904 - ...): spanischer Volksschullehrer und Erzieher; Erzieher und militanter Anarchist, für eine „selbstbestimmte“ Schule und Gesellschaft.
18. ... Solvic (1923? ... 1945): amerikanischer Arbeiter und kleiner Angestellter; anscheinend ohne jede besondere Berufung.
Wir werden längst nicht alle dieser Personen besprechen und beginnen mit denen, die Grothendieck persönlich kennen gelernt hat.
2. Marcel Légaut
Während der Arbeit an La Clef des Songes wird Grothendieck mit den Büchern des christlichen Denkers Marcel Légaut bekannt, die ihn zutiefst beeindrucken und seinem eigenen Denken eine neue Richtung geben. Es handelt sich vor allem um die Werke L'homme à la recherche de son humanité und Introduction à l´intelligence du passé et de l´avenir du christianisme. Es scheint, dass zumindest am Anfang seiner Lektüre Grothendieck nichts über das Leben Légauts weiß, das eine Reihe von bemerkenswerten Übereinstimmungen mit seinem eigenen aufweist.
Marcel Légaut (1900-1990) besuchte die französische Elite-Schule École Normale Superieure, und wird nach seinem Studium Professor für Mathematik an den Universitäten Nancy, Rennes und Lyon. Im Alter von 40 Jahren gibt er – auch unter dem Eindruck des Krieges – die gesicherte Universitäts-Laufbahn auf, um als Bergbauer und Schafzüchter auf einem einsamen Bauernhof im Departement Haut-Diois zu leben. Er heiratet, hat sechs Kinder, meditiert über seinen christlichen Glauben und seine Berufung und führt ein „spirituelles“ Leben. Nach mehr als zwanzig Jahren des Nachdenkens entschließt er sich, seine Gedanken, Meditationen, Überzeugungen, „seine Botschaft“ aufzuschreiben; die oben genannten Bücher entstehen. Sie weisen ihn weder als einen Theologen noch als einen Philosophen im eigentlichen Sinne aus, aber doch als jemanden, der von einem gewissen persönlichen Standpunkt aus tief in die Natur des Menschen und seine Stellung in der Welt eingedrungen ist. Die oben benutzte Charakterisierung als „christlicher Denker“ ist wohl die treffendste, die man in zwei Worten geben kann. Trotz aller Kritik an der Kirche wendet er sich nicht von dieser ab; die Treue auch zur (oft fraglichen und angreifbaren) Institution der Kirche ist ein ganz wesentlicher Teil seiner eigenen Religiosität und seiner Botschaft. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. Obwohl er nicht wirklich berühmt wird, sammelt er eine große Anhängerschaft, eine „Gemeinde“ um sich herum. Es kann kein Zweifel sein, dass er durch seine Schriften und durch das Vorbild seines eigenen Lebens vielen Menschen den Weg gewiesen hat.
Es scheint mir, dass Teile der Botschaft Légauts auch von Menschen, die der Kirche fernstehen und denen jede Religion suspekt oder völlig gleichgültig ist, sogar von dezidiert Ungläubigen und Atheisten in gewissem Umfang verstanden, aufgenommen, angenommen und akzeptiert werden können. Dies hängt einfach damit zusammen, dass er sich gründlich, aber auch sehr klar und direkt mit der Natur des Menschen und seiner Bestimmung beschäftigt, und zwar in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Es hängt auch damit zusammen, dass Leben und Werk Légauts außerordentlich einheitlich – „aus einem Guss“ – erscheinen und dadurch sehr an Überzeugungskraft gewinnen. Man findet bei ihm Ruhe und Sicherheit, man ist geneigt, seinen Worten zu vertrauen. (In Grothendiecks Leben empfinden wir dagegen Unrast, Brüche und Widersprüche, auch Unsicherheit in Bezug auf ganz einfache menschliche Dinge und Verhältnisse, die es schwer – vielleicht manchmal unmöglich – machen, in seine Gedankenwelt einzudringen.) Légaut verleitet zur Zustimmung, Grothendieck zum Widerspruch.
Wie dem auch sei, Grothendieck ist jedenfalls von Légaut so beeindruckt, dass sich La Clef des Songes in Richtung einer Analyse der Religion, des Glaubens, des spirituellen Lebens und des göttlichen Wirkens im einzelnen Menschen entwickelt. Es ist offensichtlich, dass auf halbem Weg, ab Juni 1987 dieses Werk eine neue Richtung nimmt. Wir zitieren zunächst einige Bemerkungen zu Légaut:
19.6.87: Ich habe in den letzten Tagen auch die Freude gehabt, mit der Kenntnisnahme des Buches L´homme à la recherche de son humanité von Marcel Légaut zu beginnen, und ich glaube, in dem Autor einen wahrhaft spirituellen „älteren Bruder“ [im Original aîne, ein Schlüsselwort dieser Meditationen] zu erkennen. Von christlicher Inspiration geleitet bezeugt dieses bemerkenswerte Buch eine innere Freiheit, eine außerordentliche Klarheit und zugleich die Erfahrung eines spirituellen Lebens und eine Tiefe der religiösen Vision, von der ich weit entfernt bin sie zu erreichen.
29./30.6.87: Légaut selbst mit der Klarsicht eines Visionärs, aber auch mit extremer Strenge und mit Bescheidenheit zeigt den Weg zur Erneuerung – nicht den Weg einer Truppe von „getreuen Gefolgsleuten“ einer toten Botschaft, sondern denjenigen, den jeder, der an Jesus glaubt, früher oder später in seinem Leben finden muss, in der Verborgenheit seines Herzens und in der Treue zu sich selbst.
18.7.87: Ich habe in den letzten Wochen reichlich Gelegenheit gehabt, zur Botschaft Marcel Légauts zurück zu kommen, die von einzigartiger Bedeutung für die heutige Welt in ihrem ganzen spirituellen Niedergang ist.
Es scheint, dass die Begegnung mit dem Werk Légauts einer der entscheidenden Anstöße gewesen ist, Les mutants zu schreiben, und Légaut ist einer dieser „Mutanten“. Offensichtlich wollte Grothendieck dann auch Légaut persönlich kennen lernen. Er hat ihn, der nicht weit entfernt wohnte, am 6.11.1987 für ein bis zwei Stunden besucht. Eine entsprechende kurze Fußnote findet sich in den Notes. Zu einem näheren Kennenlernen ist es aber offensichtlich nicht gekommen; Légaut war zu dieser Zeit ja auch schon 87 Jahre alt.
3. Fujii Guruji
Bevor Grothendieck näher mit christlichem Denken in Berührung kam, hatte er schon eine intensive Phase der Auseinandersetzung mit dem Buddhismus hinter sich, deren Höhepunkt nach eigener Aussage (Notes S. 236) in den Zeitraum 1974 – 1978 fiel. Die Einzelheiten dieser Begegnung mit fernöstlichem Denken konnten bisher nicht vollständig entwirrt werden. Jedoch scheint (etwas überraschend) die Initiative zu diesem Kontakt nicht von Grothendieck, sondern von der von Fujii Guruji (1890 – 1990) begründeten Sekte Nihonzan Myohoji (etwa „Japanische Gemeinschaft des wunderbaren Lotos-Sutra“) ausgegangen zu sein. Grothendieck schreibt dazu (Notes S. 200), dass der Mönch Fukuda shonin in einer japanischen Zeitschrift einen Artikel über Grothendiecks ökologische und antimilitaristische Aktionen im Rahmen der Gruppe Vivre et Survivre und seine Stellungnahmen zur Problematik der Wissenschaft und der naturwissenschaftlichen Forschung gelesen und daraufhin den Kontakt zu Grothendieck gesucht habe. Ein erster Missionar erschien „mir nichts dir nichts“ am 7.4.1974 bei Grothendieck. Später hat Fukuda selbst Grothendieck zweimal besucht (zuletzt um die Jahreswende 1977/78), was insofern bemerkenswert ist, als Fukuda ansonsten niemals Japan verlassen hat und, wie Grothendieck (in einem Brief an AB und CD) berichtet, kein einziges Wort irgendeiner europäischen Sprache sprach. Es ist also nicht verwunderlich, dass ab 1978 der Kontakt wieder eingeschlafen ist.
Bei diesem Mangel an Kommunikationsmöglichkeiten haben sicher andere eine wesentliche Rolle bei der Verbindung zwischen Grothendieck und dem Orden Nihonzan Myohoji gespielt, offenbar vor allem der Mönch und Mathematiker Oyama und außerdem Kuniomi Masunaga. Beide haben Grothendieck in Paris und später auch in Villecun und möglicherweise noch in Les Aumettes besucht.
Masunaga war der Anlass des Prozesses gegen Grothendieck in Montpellier im Jahr 1977 wegen „Aufnahme und Beherbergung eines illegal anwesenden Ausländers“. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1945 war noch niemals angewandt worden. Grothendieck, selbst viele Jahre seines Lebens ein Flüchtling und ein Illegaler, setzte alles daran, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses antiquierte Gesetz zu richten. Er startete eine öffentlich Kampagne und schrieb unter anderem einen offenen Brief an den Präsidenten der Republik. Offenbar setzte er in Michael-Kohlhaas-Manier alles daran, ins Gefängnis zu kommen. Der Prozess gegen den exzentrischen, aber immer noch weltberühmten Wissenschaftler wurde schließlich niedergeschlagen.
Es ist offensichtlich, dass es zwischen der kompromisslos antimilitaristischen Bewegung Nihonzan Myohoji und Grothendiecks gleich konsequenter Gruppe Vivre et Survivre Berührungspunkte gab. Beide kämpften für den Weltfrieden und als notwendige Voraussetzung dafür für die Abrüstung, insbesondere die Abschaffung aller Atomwaffen. Hiroshima erschien Grothendieck als das apokalyptische Menetekel für die Menschheit überhaupt, schlimmer noch als der Holocaust und Auschwitz. (Bei seiner eigenen Biographie und der seiner Eltern hätte man vielleicht etwas anderes erwarten können.) Wir zitieren im Original einen gesperrt geschriebenen (und damit besonders hervorgehobenen) Satz aus den Notes (S. 204):
Ce grand feu qui a embrasé Hiroshima, c´était le signe de grand Feu qui déjà embrase la Maison des Hommes !
Man kann sich auch leicht vorstellen, dass die japanischen Bettelmönche des Ordens Nihonzan Myohoji, die man in den Straßen der Großstädten antraf, die die Trommel schlugen und endlos die sieben heiligen Silben na my myo ho ren ge kyo wiederholten, die keine andere Bestimmung auf dieser Erde kannten, als den Lehren Buddhas, des Propheten Nichiren und des Erneuerers Fujii Guruji zu folgen, die Gewaltlosigkeit und Frieden forderten und in vielen Städten stupas – Friedenspagoden – errichteten, dass diese oft einfachen und ungebildeten Menschen Grothendieck beeindruckten.
Wer ist nun dieser Fujii Guruji, und was ist der Orden Nihonzan Myohoji?
Nichidatsu Fujii wurde 1885 als Sohn armer Bauern in Japan geboren. (Den Beinamen Guruji erhielt er erst später, angeblich von Gandhi.) Mit 19 Jahren wurde er Mönch und vertiefte sich in die Gedankenwelt des Buddhismus. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann seine Mission als Prediger des Weltfriedens, der Gewaltlosigkeit und der spirituellen Erneuerung des Buddhismus. Er gründete den Orden Nihonzan Myohoji, der den Lehren des Propheten Nichiren (1222 - 1282) verpflichtet ist. Er betete für den Frieden, fastete, organisierte Friedensmärsche; seine Anhänger errichteten die ersten Shanti Stupas – Friedenspagoden. Von 1918 bis 1923 durchwanderte er auf seiner Mission Korea, China und die Mandschurei. Man muss sich diese Mission auf ihre einfachst mögliche Form reduziert vorstellen: Er reiste von Stadt zu Stadt, durchwanderte die Straßen, schlug dabei unaufhörlich die Trommel und rezitierte ununterbrochen die Mantra na my myo ho ren ge kyo. Überfall fanden sich Anhänger, vielleicht nur wenige, die ihm folgten, im direktesten Sinne des Wortes. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1923 kehrte er nach Japan zurück, um spirituellen Beistand zu leisten. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1930 beschloss er, den Buddhismus in seinem Ursprungsland Indien, wo dieser inzwischen fast vollständig erloschen war, zu erneuern. Er begann seine Pilgerreise in Kalkutta, die ihn dann durch den ganzen Subkontinent bis nach Ceylon führte. In vielen größeren Städten wurden mit einfachsten Mitteln in Handarbeit mit selbst hergestellten Werkzeugen und mit grenzenloser Geduld Tempel errichtet. 1933 traf er zum ersten Mal Matamaji Gandhi, der von der Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit Fujiis zutiefst beeindruckt war. Während des Zweiten Weltkrieges setzte Fujii seine Mission fort; er sang die Mantra und schlug seine Trommel. Bei der Einweihung eines der größten Friedenstempel in Kumamote organisierte er 1954 eine große Welt-Friedenskonferenz. Ähnliche Konferenzen wiederholten sich in den folgenden Jahren in mehreren Ländern. Er bereiste die kommunistischen Länder China, Sowjetunion und die Mongolei; selbst in China errichtete er Friedenspagoden. Alle indischen Staatspräsidenten empfingen ihn. 1968 weihte der indische Staatspräsident die Friedenspagode in Rajgir ein; das große Ziel der Erneuerung des Buddhismus in Indien war erreicht. Als er schon über 90 Jahre alt war, kam Fujii zum ersten Mal nach Frankreich, um in Europa seine Mission fortzusetzen, und traf bei dieser Gelegenheit auch Grothendieck. Er starb 1985 in seinem hundertsten Lebensjahr. Es ist sein Verdienst, dass der Buddhismus in Indien wieder Fuß gefasst hat.
Fujii sah durchaus, dass gerade in Asien Christentum und Islam sich stärker ausbreiten als der Buddhismus, aber er war zutiefst davon überzeugt (vielleicht mit Berechtigung, wenn man die aggressiven Erscheinungsformen von Islam und Christentum über lange Perioden ihrer Geschichte bedenkt), dass nur der Buddhismus die Welt zum Frieden führen kann.
Es ist nicht ganz klar, wann und wie Grothendieck und Fujii sich zum ersten Mal persönlich getroffen haben; die Meditationen geben darüber keine genaue Auskunft. Es könnte bei der Einweihung eines buddhistischen Tempels in Paris gewesen sein. Grothendieck hatte sich an den Kosten der Einrichtung beteiligt und bei der feierlichen Eröffnung als prominentes Mitglied der Gesellschaft eine Rede gehalten. Später, nämlich Anfang November 1976, hat Fujii Grothendieck in Begleitung von Fukuda und Ygii-ji shonin für einige Tage in Villecun besucht. Einzelheiten werden in Les Mutants nicht mitgeteilt. (Es ist ganz generell so, dass Grothendieck in seinen Meditationen konkrete Fakten und Ereignisse nur sehr sparsam mitteilt.)
Wir zitieren jetzt einige Bemerkungen aus Les Mutants, die Grothendiecks Verhältnis zum Buddhismus, zur Sekte Nihonzan Myohoji und zu Fujii Guruji beleuchten, die klar machen, warum er Fujii Gurujii in die Liste der Mutanten aufgenommen hat, und zugleich immer auch seine eigenen Ansichten widerspiegeln:
Meines Wissens ist die Gruppe Nihonzan Myohoji die einzige religiöse Gemeinschaft der Welt, deren einziger Daseinszweck, untrennbar von ihrer religiösen Berufung, der gewaltlose Kampf für den Weltfrieden ist, verbunden mit einer totalen Ablehnung der Militärapparate und ständiger Aktion für deren Beseitigung (S. 184).
Fujii Guruji ist gleichermaßen einer der sehr seltenen Spirituellen gewesen, der in all seiner Dringlichkeit, in all seiner Schärfe und all seiner Bedeutung die gegenwärtige Krise der Zivilisation erkannt hat, sowie die Drohung der bevorstehenden totalen Zerstörung der Art Mensch durch die vereinten, untrennbar miteinander verbundenen Effekte der rasenden Entspiritualisierung der Geisteshaltungen und der Proliferation der Massenvernichtungswaffen. Er hat klar gesehen, dass auf kurze Sicht das Weiterbestehen des Lebens auf dieser Erde untrennbar verbunden ist mit einer profunden spirituellen Erneuerung [mutation], von einer Revolution der Geisteshaltungen von einer Weite und Tiefe ohne Vorbild. (S. 185)
In einer Fußnote zu diesem Abschnitt macht Grothendieck Bemerkungen, die sicher sehr charakteristisch für seine eigene Sicht der Dinge sind:
Für meinen Teil glaube ich, dass die Entspiritualisierung der modernen Welt und die senile Degeneration des religiösen Geistes im Keim schon in den religiösen Institutionen selbst angelegt sind und in Wirklichkeit mit anderen zu den Symptomen dieser „Kinderkrankheit“ der Welt gehören, die dabei ist den Höhepunkt der Krise zu erreichen und sich dann auflösen wird. Die traditionelle Opposition von „Wissenschaft“ und „Religion“ scheint mir ein anderes dieser Symptome zu sein, ...
... und jetzt noch einige weitere Zitate zu Fujii:
Auch ist Guruji einer der sehr seltenen Spirituellen gewesen, der klar den wesentlichen Unterschied zwischen der intellektuellen Dimension und der spirituellen Dimension des menschlichen Seins gesehen hat, und der gewusst hat, dass Lehre [doctrine] und Theologie in den Bereich des Intellekts gehören und dass Glaube, Liebe und Hoffnung in den Bereich des Geistes [esprit] gehören. Und er hat instinktiv gewusst, dass die Krise aller Krisen [im Original mit großen Anfangsbuchstaben] nicht durch den Intellekt gelöst werden wird, sondern durch den Geist – nicht durch die Intelligenz des Kopfes (die zweitrangig ist), sondern durch den Glauben. (S. 186)
Die vielleicht bemerkenswerteste (wenn auch etwas abwegige) Tatsache über Grothendiecks „buddhistische Phase“ ist die, dass offenbar ernsthaft davon die Rede war, ihn zum Nachfolger des inzwischen über neunzigjährigen Fujii zu machen. Dies war insbesondere auch der Wunsch des Meisters selbst. Es ist offensichtlich, dass ein Vorhaben dieser Art nicht auf dem offenen Markt gehandelt wird. Grothendieck spricht in einem Brief vom 4.8.1976 an seine deutschen Freunde von dieser Angelegenheit:
Und was wird aus mir – dem von Oyama entdeckten bzw. zusammengeheckten (unheiligen) Heiligen? So wenig ich mich auch für die mir zugedachte Rolle eigne und so wenig ich mich ihr füge – das Heiligenbild für die Fujii-Guruji-Jünger steht scheinbar festgefügt und unversehrt wie je, und meine gelegentlichen Bemühungen, es aus dem Leim zu bringen, scheinen aussichtslos. Darüber allein liesse sich schon ein ganzes Buch schreiben – lassen wir es ungeschrieben, liebe Freunde! Und kehren wir zurück zur Privatperson ...
Diese Freunde berichten, dass Grothendiecks Interesse am Buddhismus etwas einseitig und wenig „theoretisch“ war. Zum Beispiel habe er sich nicht sonderlich für die Schriften dieser Religion interessiert und sie auch nicht gründlich studiert. Allerdings ließ er sich einige Zeit lang von einem Meister einweisen, er richtete sich noch in Les Aumettes einen Gebets- und Meditationsraum ein (der vielen Besuchern als Unterschlupf zur Verfügung stand), er besaß eine große Trommel, die er selbst und die Mönche, die ihn besuchten, schlugen. Im Grunde besteht aber ein unlösbarer Widerspruch zwischen der Botschaft des Buddhismus, der ja vor allem die Selbstaufgabe in den Mittelpunkt stellt, und dem egozentrischen, oft geradezu egomanischen Charakter Grothendiecks. (Damit soll nicht etwa abgestritten werden, dass Grothendieck in seinem Verhalten gegenüber anderen in vielen Fällen ganz außerordentlich hilfsbereit, großzügig und freigiebig war. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er in seinen Gedanken und Meditationen niemals von sich selbst loskam.)
Im Anschluss an Fujii bespricht Grothendieck dann ausführlich das Leben und Wirken von Mathama Gandhi, ebenfalls einer auf der Liste der 18 Mutanten. Er erkennt viele Gemeinsamkeiten zwischen Fujii und Gandhi, vor allem im Prinzip der Gewaltlosigkeit, der Bedeutung der Spiritualität und der völligen Gleichgültigkeit (oder sogar Ablehnung) gegenüber der Wissenschaft.
4. Félix Carrasquer
Der einzige der mutants, zu dem Grothendieck über längere Zeit eine enge persönliche Verbindung gehabt hat, ist Félix Carrasquer (1905 – 1993). Er nennt ihn seinen ältesten und besten Freund. Genaues über diese Beziehung konnte aber nicht ermittelt werden. Zum Beispiel wissen wir nicht, wie sie sich kennen gelernt haben. Carrasquer war ein spanischer Anarchist und – wie wir noch sehen werden – ein bemerkenswerter Schulreformer. Vielleicht finden wir in der Freundschaft mit ihm einen Widerhall des anarchistischen Vermächtnisses seines Vaters. In jedem Fall kann man feststellen, dass Carrasquer mit seinem höchst abenteuerlichen Lebenslauf sich nahtlos einfügt in die Reihe der Menschen, die Grothendieck nahe standen und in seinem Leben eine Rolle spielten.
Grothendieck widmet etwa vierzig Seiten von Les Mutants der Biographie und dem Lebenswerk seines Freundes. Man kann diese Seiten, anders als das meiste, was Grothendieck sonst geschrieben hat, als eine „hommage an einen Freund“ lesen, und wir zitieren jetzt (in etwas freier Übersetzung) aus diesem Text, wobei wir die einzelnen Abschnitte zeitlich ordnen und teilweise etwas kürzen. Wir zitieren etwas ausführlicher, als es für die Zwecke dieses Essays erforderlich wäre, um auf die wenig bekannte Persönlichkeit Carrasquers aufmerksam zu machen. Grothendiecks eigener Text ist unterbrochen durch Zitate aus Briefen von Carrasquer, die durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind.
Félix verbrachte die ersten vierzehn Jahre seines Lebens in dem Dorf, in dem er [1905] geboren wurde, in Albate de Ciena, wo sein Vater Gemeindesekretär war. Ein lebendiges und wissbegieriges Kind, lernte er schon früh lesen und verschlang alles gedruckte, das ihm in die Hände fiel. Er brannte darauf mit den größeren Kindern endlich zur Schule zu gehen. Aber als es endlich so weit war, verbrachte er keinen einzigen Tag in der Schule. Abgestoßen von der Brutalität und dem Stumpfsinn, der sich dort zur Schau stellte, rettete er sich schon am zweiten Tag ... Seine Eltern waren vernünftig genug, nicht darauf zu bestehen, dass er wieder zur Schule zurück kehrte. Er verbrachte seine Kindheit in vollständiger Freiheit, ... Abgesehen von diesem ersten Versuch im Alter von sechs Jahren setzte er nie wieder einen Fuß in eine staatliche Schule – schon gar nicht als Schüler. Er hat niemals ein Examen gemacht, kein pädagogisches oder irgend ein anderes. Aber das verhinderte nicht, dass er schon von frühem Alter an eine Passion für Erziehung entwickelte und zugleich eine Passion für die Schule – aber eine Schule würdig dieses Namens. Er sagt, dass er diese Passion nur entwickeln konnte, weil er niemals eine gewöhnliche Schule, eine Dressur-Schule, besuchte ... Ganz entschieden war es möglich etwas besseres zu machen. Und während seines ganzen Lebens, sah er das als das wichtigste an, als das, was vordringlich getan werden musste.
Schon im Alter von vierzehn Jahren kam er zu der Überzeugung, dass er in dem Dorf alles gelernt hatte, was er dort lernen konnte, und er eröffnete seinem Vater, dass er nach Barcelona gehen werde. ...
„Die Stadt und seine Bewohner verschiedenster Sorte boten vielfältige Attraktionen. Aber der Fixpunkt meiner ganzen Aufmerksamkeit war das Viertel von Atarazanas mit seinen öffentlichen Büchereien. Unendliche Schätze gab es dort zu entdecken. ...“
Es geschah in diesen Jahren, dass Félix sich eine vollständig autodidaktische Ausbildung von enzyklopädischem Umfang erarbeitete. Er fuhr fort, sein Leben bei jeder Gelegenheit zu bereichern, durch Lektüre, Unterhaltungen, Radiosendungen, Nachdenken ... Es war auch in diesen Jahren, dass ihm seine Berufung als Erzieher klar bewusst wurde und von nun an einen zentralen Platz in seinem Leben einnahm. ...
„ ... Ich war dreiundzwanzig alt, als ich mich entschloss, in das Dorf zurückzukehren um eine Arbeit zu beginnen, die meinem eigentlichen Bestreben entsprach. Die Diktatur von Primo de Rivera war zu Ende gegangen (1928), und es gab zahllose Schwierigkeiten, die Leute für eine neues Erziehungswerk zu mobilisieren. ... In diesem Augenblick kam mein Freund Justo ins Dorf zurück. Er hatte einige Jahre im Gefängnis verbracht ... In unserem ersten Gespräch schlug er vor, eine Bibliothek einzurichten. Ich gab dreißig oder vierzig Bücher aus meinem Besitz und er ein Dutzend. Und die Dinge nahmen ihren Lauf!“
Aber viele Dorfbewohner konnten nicht lesen oder, schlimmer noch, sahen nicht die Notwendigkeit, es zu versuchen. Es mussten die einen lesen lernen, um dann die anderen anzuregen, das auch zu tun, oder genauer gesagt, es mussten alle angeregt werden zu lesen, sich auszudrücken und über die Welt nachzudenken, die sie umgab. Dafür musste eine Schule gegründet werden mit Abendkursen für Kinder und Erwachsene. ...
„ ... Man konnte Junge und Alte sehen, und mit welcher Begeisterung diskutierten sie soziale Fragen, landwirtschaftliche und wissenschaftliche Probleme und alles mögliche andere! ...
Etwas später in der republikanischen Zeit und nachdem die Leute das Vermögen des Herzogs von Solférino erhalten hatten, nahm sich der Kultur-Kreis ein größeres Projekt vor und realisierte es: einen kollektiven Agrarbetrieb, ein Versuchsgut und eine Reformschule mit der Beteiligung der Jungen und der Mädchen im Alter von sechs bis vierzehn Jahren in einem Klima von Freiheit, Kooperation und Verantwortung.“
Diese erste erzieherische Erfahrung in seinem Geburtsort, die in einer Atmosphäre intensiver ideologischer und sozialer Gärung geschah, hat, wie mir scheint, das Modell für die beiden späteren pädagogischen Unternehmungen abgegeben, die denselben Grundton hatten: vollständige Freiheit und brüderliche Kooperation zwischen allen Beteiligten. Für Félix war diese Kooperation etwas ganz anderes als nur eine Frage der „Methode“, ...
Diese fruchtbare Arbeit verfolgt er fünf Jahre lang, von 1928 bis 1933; ein oder zweimal gab es wegen der gespannten politischen Lage Unterbrechungen. Das vorzeitige Ende kommt nach einem doppelten Schock. Schon 1932 machte sich bei Félix eine Retina-Degeneration bemerkbar, und einige Monate lang ist er zu vollständiger Untätigkeit verurteilt. Nach einer Besserung (die sich dann von kurzer Dauer erwies) kehrt er zu seiner Aufgabe zurück. Aber im folgenden Jahr zwingt ihn die aufgewühlte politische Situation, in der er sich vollständig und in riskanter Weise engagiert, sein Heimatdorf überstürzt zu verlassen. Er flüchtet nach Lérida, und im gleichen Jahr (1933) verliert er endgültig sein Augenlicht. Das war ein schrecklicher Schlag für diesen intensiv lebenden und aktiven Mann und gleichzeitig eine schwere Bürde, die er ein langes Leben lang tragen musste. Aber sein revolutionärer Glaube und der Glaube in seine Mission – ein Beispiel für eine neue Art der Erziehung zu schaffen – war nicht im mindesten erschüttert. Heute, ein halbes Jahrhundert später, in einer laschen Welt, die stagniert und auseinander fällt, ist dieser Glaube, diese unsinnige Hoffnung immer noch lebendig und wirksam ...
In Lérida macht er die Bekanntschaft einer Gruppe von Volksschullehrern, die beeinflusst von Freinet, auf dem Land in der Schule eine Druckerei eingerichtet hatten. Félix ist sofort von den Ideen von Freinet gefesselt. Er interessiert seinen jüngeren Broder José dafür ...
Zwei Jahre später (1935) treffen die beiden Brüder sich mit einem dritten, Francisco, und ihrer Schwester Presen in Barcelona, und mit der enthusiastischen und rückhaltlosen Unterstützung einer Gruppe neuer Freunde arbeiten sie an dem Projekt einer vollständig „selbstbestimmten“ Schule [école autogérée]. Die Examina von José erweisen sich als höchst wertvoll für die legale Gründung der Schule: es ist die „École Elysée Reclus“ in der Rue Vallespir.
Zwischenzeitlich hat Félix Gelegenheit, sich mit dem pädagogischen Denken von freiheitlich gesinnten Denkern wie Godwin, Saint Simon, Proudhon, Bakunin, Reclus bekannt zu machen. Er nimmt das mit Begeisterung auf ... Aber er sagt, dass den stärksten Eindruck auf ihn Léon Tolstoi und dessen pädagogische Erfahrungen in Yasnaia Poliana gemacht habe. ...
Die beiden wichtigsten pädagogischen Unternehmungen und Erfahrungen, die Félix gemacht hat, sind zwei „selbstbestimmte“ Schulen, die er gegründet und mit Leben gefüllt hat. ... Für ihn ist eine selbstbestimmte Schule eine Schule, die den Schülern gehört ... und in der alles, was die Schule betrifft, ohne jede Ausnahme, gemeinsam diskutiert und entschieden wird. ...
Die École Élysée Reclus war die erste selbstbestimmte Schule. Sie hat nur im Schuljahr 1935/36 richtig funktioniert; dann wurde sie vom Bürgerkrieg unterbrochen. Sie war praktisch ein Familienunternehmen, denn die vier ständigen Lehrer waren die drei Brüder und ihre Schwester ... Die Schule arbeitete unter der Schirmherrschaft und mit der Unterstützung des Comité de l'Athénée, einer liberalen und freiheitlich gesinnten Kulturorganisation, die in ganz Spanien verbreitet war. ...
Die zweite selbstbestimmte Schule, die von Félix gegründet und inspiriert wird, ist die „Schule der Kämpfer von Monzon“ [l´École des Militants de Monzon]. Es ist eine Schule auf dem Lande in Aragon, die während zweier Jahre im Bürgerkrieg von Januar 1937 bis Januar 1939 besteht. Dieses Mal ist es eine Schule für ältere Jungen und Mädchen, vierzehn- bis siebzehnjährige, die zusammen in einem Internat leben. Ihre Zahl schwankt zwischen vierzig und sechzig. Félix ist der einzige Erwachsene unter ihnen, und es ist Krieg! Während der zwei Jahre geht eine beträchtliche Zahl der älteren Jungen an die Front, die anderen widmen sich gemeinsam administrativen und organisatorischen Aufgaben im Hinterland. Neue Schüler ersetzen sie. Insgesamt durchlaufen zweihundert Schüler die Schule. ... Aragon ist während dieser Zeit in 25 Agrar-Kollektive („Comarcals“) aufgeteilt, die insgesamt 601 Dörfer mit 300000 Familien umfassen, die für eine freiwillige Kollektivierung optiert haben. Unter diesen Kollektiven ist die von Monzon, die 32 Dörfer zusammenfasst. ...
Die Hauptaufgabe der Schule ist es, den jungen Menschen den Geist der Verantwortung und Eigeninitiative zu vermitteln, die sie zur Übernahme von administrativen und organisatorischen Aufgaben für die Kollektive befähigt. ... Sehr schnell kann die Schule sich dank ihrer Agrarproduktion selbst erhalten. ... Über diese Sache schreibt mir Félix im Rückblick nach einem halben Jahrhundert:
„Die wichtigste Erfahrung in Monzon war, dass mit täglich drei Stunden landwirtschaftlicher Arbeit für jeden die ökonomische Bedürfnisse aller erfüllt werden konnten. Wenn sich diese Art von Schule allgemein einführen lässt, so heißt das also, dass die wirtschaftlichen Bedürfnisse von Millionen und Milliarden erfüllt werden können, dass man mit einer Beschäftigung der Kinder aufhören kann, die sie nur verdummt, und dass man eine wahre Verbindung von Theorie und Praxis in einer gemeinsamen Lebensweise einführen kann, die alle bereichert.“ ...
Die Schule von Monzon wurde gegründet aus den unmittelbaren Notwenigkeiten einer freiheitlichen Revolution im ländlichen Milieu, aber sicher immer auch mit Hinsicht auf eine größere Vision – die sich niemals erfüllte. Als im April 1938 Aragon [im Bürgerkrieg] fällt, wird die Schule in aller Hast nach Katalonien in die Nähe von Barcelona transferiert ... In letzter Stunde, im Augenblick der vollständigen Niederlage im Januar 1939 wird sie aufgelöst. Félix flüchtet in letzter Sekunde nach Frankreich; vier Jahre Konzentrationslager warten auf ihn – der Preis, dass er dem Erschießungskommando entkommen ist. Eine beträchtliche Zahl der Schüler von Monzon fallen an der Front. Auch sein Bruder José ...
Grothendieck berichtet dann in seinem Text ausführlich über Organisation, Arbeitsweise und Geist der von Carrasquer gegründeten Reformschulen. Er erkundigt sich während der Redaktion mehrfach in langen Telefongesprächen mit Carrasquer nach Einzelheiten und erhält offenbar auch einige Briefe von diesem. Insgesamt wird erkennbar, dass Grothendieck sich intensiv mit den pädagogischen Reformbewegungen verschiedener Art befasst hat und dass dies eine Sache ist, die ihn persönlich interessiert. Insbesondere vergleicht er ausführlich die Schule von Summerhill mit den Gründungen von Carrasquer und fragt auch diesen zu seiner Meinung über Summerhill. In dem ganzen Text von Grothendieck klingt eine Sympathie und ein freundschaftliches Wohlwollen durch, das man sonst selten in seinen grüblerischen, oft moralisierenden und nicht selten besserwisserischen Texten findet. So schreibt er auch voller Bewunderung über die Ereignisse von Aragon:
... Dies war, glaube ich, das einzige Mal in der Geschichte aller Völker, dass das freiheitliche Ideal der Kooperation und Solidarität ohne jede Hierarchie in einer großen Provinz eingeführt wurde – von Männern, Frauen und Kindern, die alle von derselben Kraft getragen wurden. ... Félix' Bericht darüber ist ein Dokument von skrupulöser Ehrlichkeit, geschrieben von einem Menschen, der seit seinen jungen Jahren im Herzen dieser Bewegung agierte, die in diesen drei fruchtbaren und glühenden Jahren kulminierte. ...
Über die nächsten fünfzig Jahre von Carrasquer's Leben erfahren wir dann etwas verstreut und etwas unzusammenhängend nur noch das Wichtigste:
... Seit dem abrupten Ende des Experimentes von Monzon ist ein halbes Jahrhundert (minus ein Jahr) vergangen. ... Félix verbrachte von diesem halben Jahrhundert sechzehn Jahre in Gefangenschaft, gefolgt von elf Jahren Exil in einem fremden Land, wo er das Ende des eisernen Regimes von Franco erwartete. Tatsächlich kehrten er und Mati [seine Frau] mit kalkuliertem Risiko schon 1971 zurück. ... Während seines Exils in Frankreich unter den spanischen Emigranten mangelte es ihm nicht an Gelegenheit, in Vorträgen und in Publikationen die Idee der freiheitlichen Erziehung und der selbstbestimmten Schule zu vertreten. ... Anfang der sechziger Jahre nach seiner Übersiedlung in die Pariser Gegend versuchte er im Milieu der spanischen Emigranten ein „Centro de Estudios Sociales“ nach dem Vorbild der Erfahrungen in seinem Heimatdorf Albalate und später in Barcelona zu gründen. Es wurde ein Misserfolg. ...
In den Jahren seit ihrer Emigration nach Frankreich bis zu ihrer heimlichen Rückkehr nach Spanien im Jahr 1971 lebten Félix und Mati mit ihrer Familie auf dem Lande in der Nähe von Toulouse, wo sie sehr bescheiden mit den Erträgen einer kleinen Geflügelfarm auskommen mussten. Unsere beiden Familien waren eng befreundet, und wir verbrachten beinahe jede große Ferien bei ihnen, mit allen Kindern ... Sie haben uns mit ihrer Freundschaft und großen Reife in schwierigen Momenten sehr geholfen ... Das sind Dinge, die man nicht vergisst. Seit ihrer Rückkehr nach Spanien haben wir uns ein wenig aus den Augen verloren, aber ich glaube, dass es keine Übertreibung ist, wenn ich sage, dass Félix und Mati – jeder in seiner Weise – die nächsten Freunde gewesen sind, die ich in meinem Leben gehabt habe und auf die ich mich absolut verlassen konnte, wenn sich die Gelegenheit ergab.
Félix und seine Frau Mati sind alte Freunde und sie sind auch „Familienfreunde“. Ich machte 1960 ihre Bekanntschaft, also vor fast dreißig Jahren. Félix war vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er zwischen 1946 und Februar 1959 zwölf Jahre verbracht hatte. Er war 1946 in Barcelona wegen politischer Untergrundarbeit verhaftet worden, als er daran beteiligt war die CNT (Confederacion Nacional de los Trabajadores) wieder zu gründen. Er und Mati sind Anarchisten, und ihr pädagogisches Engagement ist untrennbar verbunden mit ihrem militanten politischen. Nach der Niederlage der spanischen Revolution und dem Debakel der anarchistischen und republikanischen Kräfte Ende 1938, Anfang 1939 flüchtet Félix sich im Februar 1939 nach Frankreich, wo er das Schicksal der spanischen Flüchtlinge teilt ... die von einer französischen Regierung, die sich „Nationale Front“ nannte, in hastig errichteten Konzentrationslagern interniert werden. Félix verbringt vier Jahre im Lager von Noe. Dann gelingt es ihm im Oktober 1943 auszubrechen. Das war keine kleine Tat: zu dieser Zeit war er schon seit zehn Jahren blind. Er kehrt im Mai 1944 nach Spanien zurück und nimmt seine politische Untergrundarbeit wieder auf. ... Er verbringt zwölf Jahre in den Gefängnissen Francos, was für ihn um so härter ist, da er blind ist und in diesen Jahren nicht lesen und schreiben kann. Es war einer der glücklichsten Tage seines Lebens, als er sich am 7. Februar 1959 vor den Gefängnismauern wiederfindet. ... nach einem Jahr erhält er die Erlaubnis, nach Frankreich zu emigrieren, allerdings unter der Auflage, niemals nach Spanien zurück zu kehren.
... Er traf sie [Mati] zum ersten Mal 1935 in der Schule von Vallespir. ... Sie war selbst Lehrerin, mit Kopf und Seele ganz ihrer pädagogischen Arbeit verpflichtet. ... Sie muss klar die Bedeutung der pädagogischen Mission Félix' erkannt haben und sie verschrieb sich dieser Mission mit allen ihren Fähigkeiten. Sie traf Félix 1946 erneut wieder, als er im Untergrund arbeitete, und von diesem Augenblick an führten sie ein gemeinsames Leben. ... Auch sie verbrachte wegen politische Delikte ein oder zwei Jahre im Gefängnis. Nach Félix' Entlassung aus dem Gefängnis trafen sie sich wieder und ein Jahr später wählten sie den gemeinsamen Weg ins Exil.
Grothendieck berichtet, dass um die Jahreswende 1987/88 Carrasquer damit beschäftigt ist, seine Autobiographie zu schreiben, und dass bereits 800 Seiten in Maschinenschrift vorliegen. Ob diese sicher höchst interessante Autobiographie erschienen ist, scheint zweifelhaft. Google kennt sie jedenfalls Ende 2004 nicht.
Es ist offensichtlich, dass Félix Carrasquer in die Liste der Mutants passt: Anarchie (im Sinne von Selbstbestimmung ohne staatlichen Zwang), Freiheit und Erziehung zur Freiheit sind die Eckpfeiler seiner Philosophie, und entscheidend ist ganz gewiss auch, dass sein Blick nicht nur auf die Gegenwart gerichtet ist, sondern vor allem auf die Zukunft – auf das, was Grothendieck als das kommende Neue Zeitalter sieht. Das Beispiel Carrasquer zeigt aber auch, dass Religiosität nicht notwendig zu Grothendiecks Bild des „Mutanten“ gehört. Carrasquer war Anarchist und sicher anti-religiös eingestellt. Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass Grothendiecks zentraler Begriff der Spiritualität auch eine nicht-religiöse Komponente umfasst.
5. Die Themen
Bevor wir auf weitere der Mutanten zu sprechen kommen, soll kurz gesagt werden, unter welchen Gesichtspunkten Grothendieck das Leben, das Werk und die „Vision“ der Mutanten diskutiert. Er identifiziert insgesamt zehn Themenkreise, die von besonderer Bedeutung für seine Weltsicht sind. Soweit möglich versucht er die Einstellung jedes der Mutanten zu diesen Themen zu besprechen (oder wenigstens Vermutungen darüber vorzubringen). Man könnte sagen, dass er sich eine Matrix vorstellt: achtzehn Personen, zehn Themen. Diese Themen sind die folgenden:
1) Sexus (sexe)
2) Krieg (guerre)
3) Selbsterkenntnis (connaissance de soi)
4) Religion (es folgt eine ziemlich ausführliche Erklärung, was gemeint ist ; jedenfalls nicht die Kirche als Institution und auch nicht die Liturgie)
5) (Natur-)Wissenschaft (science)
6) Kultur ( la civilisation actuelle et ses valeurs, „culture“)
7) Eschatologie (la question des destinées de l'humanité dans son ensemble, «eschatologie»)
8) Soziale Gerechtigkeit (justice sociale)
9) Erziehung (education)
10) Spiritualität („science de demain“ ou „science spirituelle“).
Bevor wir auf einzelne dieser Aspekte etwas genauer eingehen, sind vielleicht einige wenige erläuternde Bemerkungen angebracht. Zunächst sind diese Themen in etwa den drei fundamentalen Ebenen des Menschen (körperlich – intellektuell – spirituell) folgend angeordnet. Deshalb erscheint sexe an erster Stelle, aber sicher auch, weil Grothendieck mit Neill der Überzeugung ist, dass sexuelle Freiheit Voraussetzung für Freiheit überhaupt ist. Er schreibt (S. 316; im Original ab la clef gesperrt und damit besonders hervorgehoben):
Mais je crois que Neill a été le premier homme dans notre longue histoire qui ait eu cette audace et cette innocence de voir que la clef de la liberté de l´homme est dans la «liberté sexuelle».
Krieg ist für Grothendieck das Übel der Menschheit schlechthin, die Ablehnung von Militär und militärischer Gewalt ein Kernpunkt seiner Botschaft. Selbsterkenntnis ist für ihn vielleicht weniger ein Ziel an sich als die notwendige Voraussetzung, um zur wahren Spiritualität zu gelangen und den Willen des „Guten Gottes“ auf dieser Welt zu verkünden und zu verwirklichen. Bekanntlich hat er in dem „Brief von der Guten Neuigkeit“, in dem er das Neue Zeitalter ankündigt, von seinen Korrespondenten als erstes Selbsterkenntnis verlangt, und die letzten Besucher, die zu ihm gefunden haben, hat er mit der Aufforderung weggeschickt, sie müssten erst einmal zu sich selbst finden.
Wissenschaft ist – bei aller Kritik und Distanz – immer noch der Schlüssel um die Welt und den Menschen zu verstehen, und mehr als einmal sagt Grothendieck, dass seine eigene Bestimmung die Wissenschaft gewesen sei. Dabei ist nicht ganz klar, wie das zu verstehen ist, denn andererseits spricht er von seiner Zeit als aktiver Mathematiker, z.B. in Recoltes et Semailles, immer wieder nur als einer „Reise durch die Wüste“. Am überraschendsten ist es vielleicht, welche Bedeutung Grothendieck der „Erziehung“ beimisst. Hier zeigt sich ein unbekannter Grothendieck. Es wurde schon aufgezeigt, wie gründlich er sich mit den Reformansätzen seines Freundes Carrasquer beschäftigt hat. Ähnlich ausführlich diskutiert er Neill und Summerhill, und auch bei einigen anderen der Mutanten rückt er den Gesichtspunkt des Lehrers in den Vordergrund.
Und schließlich ist bei allen die entscheidende Frage, was sie zur „Welt von morgen“, zum „Neuen Zeitalter“ der Menschheit beitragen – sei es durch ihr persönliches Beispiel, sei es durch ihr Verständnis der wahren Natur des Menschen, sei es durch angestoßene Reformen und Erneuerungen.
6. Bernhard Riemann
In der Liste der Mutanten ist Bernhard Riemann (1826 – 1866) der einzige Mathematiker und der einzige, der nur als Wissenschaftler bedeutend ist. Zwar sind auch Charles Darwin und Siegmund Freud, zwei weitere Mutanten, in erster Linie Wissenschaftler, aber sie haben vor allem auch unser Bild vom Menschen grundlegend und nachhaltig verändert, was man von Riemann gewiss nicht sagen kann. Grothendiecks Kenntnis von Riemann und seinem Leben stützt sich ausschließlich auf den schmalen von Weber und Dedekind herausgegebenen Band seiner „Werke“ (den er vor längerer Zeit gelesen und bei der Niederschrift der Mutants sicher nicht zur Verfügung hatte). Ganz besonders beeindruckt haben ihn die im Anhang abgedruckten „Fragmente philosophischen Inhalts“. Es ist erstaunlich, dass bei diesen wenigen Quellen, Grothendieck doch ein recht klares und wohl auch zutreffendes Bild von Riemann entwirft.
Wenn man über Riemann und Grothendieck spricht, so muss man vielleicht als erstes eine Frage beantworten, die sich sofort aufdrängt: Anscheinend erwähnt Grothendieck in seinen Meditationen kein einziges Mal die „Riemannsche Vermutung“. Das ist sicher eine bemerkenswerte Tatsache, wenn man bedenkt, dass diese Vermutung zweifellos seinem eigenen mathematischen Werk die Richtung gewiesen hat. Grothendieck sagt selbst, dass ein wesentliches Ziel seines Neuaufbaus der Algebraischen Geometrie der Beweis der Weil-Vermutungen (also der Riemann-Vermutung für algebraische Varietäten über endlichen Körpern) gewesen sei, und man darf sicher sein, dass er auch die ursprüngliche Riemann-Vermutung als Fernziel vor Augen gehabt hat. In seinen Meditationen und auch in Les Mutants scheint ihn Riemann jedoch nur als Naturphilosoph zu interessieren. Er erwähnt explizit Riemanns Arbeit zur „Mechanik des Ohres“, seinen „Beitrag zur Elektrodynamik“ und die „Fragmente philosophischen Inhalts“.
Besonderen Wert legt Grothendieck auf Riemanns Bemerkungen zur möglichen diskreten Struktur des physikalischen Raumes. Er erwähnt diesen Sachverhalt mit besonderer Betonung mindestens dreimal, in Recoltes et Semailles (S. P 58), in den Notes über den Mutanten Riemann (S. 299) und in einem Brief zur Physik vom 24.6.1991 an einen unbekannten Adressaten. Es ist nicht ganz klar, auf welche Bemerkungen Riemanns sich das beziehen könnte. In den „Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen“ schreibt Riemann nur „ ... Es muss also entweder das dem Raum zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder ...“, und in dem Fragment „Zur Psychologie und Metaphysik“ notiert er die Antinomie: „Endliche Raum- und Zeitelemente. [versus] Stetiges.“ Mehr lässt sich nicht finden. Es ist allerdings gut vorstellbar, dass die Idee eines diskreten Raumes für Grothendieck, der sich selbst immer als Geometer sieht, sehr naheliegend ist (Stichwort „Schema“!).
Konkret sagt Grothendieck nur sehr wenig über Riemann. Wir zitieren ein paar Zeilen, die alles wesentliche enthalten:
Bei meiner Lektüre [von Riemanns Werken] vor sehr langer Zeit habe ich mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen, dass Riemann ein tief religiöser Mensch war. Die philosophischen Notizen, die uns überliefert sind, lassen das spüren, und zugleich zeigen sie uns eine Tiefe und Unabhängigkeit der Weltsicht [vision], die bei weitem die Art der Einstellung und der Ideen übertrifft, die zu allen Zeiten die Denker eingeengt hat ... Sein besonderes Genie, sowohl in der Mathematik als auch in allen anderen Gebieten, denen sich sein Geist zugewandt hat, besteht in einem erstaunlichen Sinn für die zentralen und fundamentalen Fragen und für die Strukturen, die diese suggerieren, und in einer Freiheit, die mir total erscheint (und wie sie ganz gewiss nur wenige Menschen im Laufe unserer Geschichte erreicht haben) ... In einem Grade, der nur selten erreicht wird, stellt er für mich einen Geist dar, der sich vom Atavismus der Herde befreit hat.
Im übrigen passt Riemann aber nicht besonders in die Liste der Mutants; er hebt sich deutlich von allen anderen ab: Riemann war eine schüchterne, geradezu gehemmte Persönlichkeit, der kaum etwas mit den extrovertierten, aktiven Männern der Liste gemeinsam hatte. Er wollte nicht die Welt verändern, er wollte nicht einmal eine einzelne Person von irgend etwas überzeugen, man kann ihn sich nicht als Redner, nicht einmal als „Lehrer“ vorstellen, er hat sich weder für Freiheit, noch für Anarchie, von selbstbestimmter Sexualität ganz zu schweigen, nicht einmal für seine Religion eingesetzt. Er war ein genialer Mathematiker, und vielleicht hat er, wie Grothendieck sagt, zu einer ungewöhnlichen inneren Freiheit gefunden. Vielleicht ist er ein Vorläufer eines kommenden Zeitalters, aber er kündigt es gewiss nicht an.
Es gibt noch einen Berührungspunkt zwischen der Gedankenwelt Riemanns und der Grothendiecks, den mancher vielleicht als etwas bizarr empfinden wird. Anscheinend glaubte Riemann, dem deutschen Philosophen Fechner folgend, an die Beseeltheit der Pflanzen (und darüber hinaus zum Beispiel auch an die Beseeltheit der ganzen Erde). Der Glaube an die Beseeltheit der Pflanzen ist nun eine ganz wesentliche Komponente in Grothendiecks Spiritualität. Seit seinem „endgültigen“ Verschwinden 1991 lebt er in enger spiritueller Gemeinschaft mit Pflanzen, er spricht von ihnen als seinen „Freundinnen“ und anscheinend versucht er auch durch chemisch-alchimistische Prozesse ihre Seele oder Psyche zu destillieren. Es scheint, dass er den ganz seltenen Besuchern in dieser Zeit gelegentlich diese destillierten Pflanzen-Seelen als Geschenk angeboten hat.
7. Edward Carpenter
Will man versuchen, Edward Carpenter (1844 – 1929) mit zwei Worten zu charakterisieren, so würde man ihn vielleicht einen mystischen Sozialisten nennen. Er war Schriftsteller, Dichter, Denker, Philosoph und Universitätsreformer, ein Bewunderer Walt Whitmans und vor allem im puritanischen England seiner Zeit ein Vorkämpfer für die Rechte der Frauen und der Homosexuellen (beiderlei Geschlechtes). Er studierte fernöstliche Religionen und schloss sich der sozialistischen Bewegung an. Sein dichterisches Hauptwerk mit dem bezeichnenden Titel Towards Democracy ist eine Sammlung von etwa 300 lyrischen Gedichten. Er schrieb Bücher über die Rolle der Sexualität in der Gesellschaft Love´s Coming-of-Age, The intermediate Sex, Intermediate Types among Primitive Folks, in denen er sich vor allem für die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen und der Homosexuellen einsetzt, und eine Autobiographie My Days and Dreams.
Es scheint, dass die Auswahl der in Abschnitt 5 aufgeführten Themen wesentlich von Carpenter beeinflusst wurde. Zumindest kann man eine weitgehende Übereinstimmung zu zentralen Fragen im Denken Carpenters finden. Grothendieck schreibt (S. 648):
Unter den „Azimuts“ (oder „Regionen“) der menschlichen Existenz, die Carpenter ausgelotet hat, [...] kann ich die folgenden erkennen: der Sexus und die fleischliche Welt der Sinne und der Wahrnehmungen; die Religion und die religiöse und mystische Erfahrung; die Wissenschaft: die des Ursprungs und der Vergangenheit, die unserer Zeit und die von morgen ... ; die Kunst und ihre Beziehung zum Leben; der schöpferische Prozess in der Psyche und im Kosmos und vor allem in der Evolution; Moral, die Sitten und Gebräuche im menschlichen Leben und im tierischen; die Gesellschaft und ihre Evolution; die sozialen Bewegungen und der Kampf um soziale Gerechtigkeit (ein Kampf, an dem er selbst aktiv teilgenommen hat); die Verteidigung der Verweigerung des Kriegsdienstes aus Gewissensgründen und der Kampf gegen den Krieg; die Kritik am Rechtssystem und den Gefängnissen und die „Verteidigung der Kriminellen“; die politische Ökonomie; die Beziehung des Menschen zur Erde und zur animalischen und vegetativen Welt (die die Praxis der Vivisektion als eine unwissende und barbarische Überschreitung der kosmischen Gesetze erkennt, die für den Menschen und seine tierischen Brüder gelten); die Beziehung des Menschen zu seiner Arbeit und zum Ergebnis seiner Arbeit, die Beziehungen zwischen dem Produzenten und dem Käufer und Verbraucher; ein profundes Verständnis der Gemeinsamkeiten der großen Mythen, die man quer durch alle Religionen findet, als ein Aspekt einer „universellen Religion“ [...]; die Geschichte der Religion, der Wissenschaft und der Kunst (aus der Religion in ihrem ursprünglichen Zustand geboren) in einer evolutionistischen und eschatologischen Vision um die Humanität zu erreichen und die Bestimmung der Seele eines jeden ...
8. Eddie Slovik
Völlig aus dem Rahmen der Mutanten scheint Slovik zu fallen, und es soll wenigstens ganz kurz mitgeteilt werden, was es mit ihm auf sich hat, zumal die meisten Leser diesen Namen zweifellos noch nie gehört haben. Wir stützen uns dabei zunächst auf das, was Grothendieck selbst an verschiedenen Stellen in den Notes sagt. Er schreibt dabei selbst aus dem Gedächtnis; das unten erwähnte Buch hat er nicht mehr zur Hand.
Slovik ist der einzige Soldat in der Geschichte der amerikanischen Armee, der seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg wegen „Desertion angesichts des Feindes“ von einem Militärgericht verurteilt und anschließend exekutiert wurde. Der Vorfall hatte sich in den letzten Kriegswochen im Zuge der Kämpfe bei der Ardennen-Offensive ereignet. Offenbar musste wegen zunehmender Desertationen und Befehlsverweigerungen ein Exempel statuiert werden. Der Fall gelangte bis vor den „Generalissimus in Person“ Eisenhower, und dieser bestätigte das Todesurteil. In der Wikipedia-Enzyklopädie heißt es u.a.:
On October 8, Slovik told his company commander ... that he was „too scared“ to serve in a rifle company and asked to be reassigned to a rear area unit. He also told Grotte he would run away if assigned to a rifle unit and asked if that would be desertion. Grotte told him it would be desertion and refused his request …
On October 9, Slovik went to an MP and gave him a confession in which he wrote he was going to “run away again” if he was sent into combat. Slovik was brought before Lieutenant Colonel Ross Henbest, who offered Slovik an opportunity to tear up the note and face no further charges. Slovik refused and wrote a further note stating that he understood what he was doing and its consequences.
Slovik was taken into custody and confined to the division stockade. The divisional judge advocate … again offered Slovik an opportunity to rejoin his unit and have the charges suspended. He also offered Slovik a transfer to another infantry regiment. Slovik declined these offers and said, “I´ve made up my mind. I´ll take my court martial.”
… The nine officers of the court found Slovik guilty and sentenced him to death. …
On December 9, Slovik wrote a letter to Gen. Dwight D. Eisenhower, … pleading for clemency, but desertion had become a problem and Eisenhower confirmed the execution order… Slovik´s death by firing squad … was carried out at 10:04 on January 31, 1945, …
… Although his wife and others have petitioned seven U.S. Presidents, Slovik has not been pardoned.
Grothendieck hatte bereits im Frühjahr 1955 bei seinem Aufenthalt in Kansas von dem Fall durch das Buch The execution of the private Slovik des amerikanischen Journalisten William Bradford Huie erfahren. Er hatte diese Taschenbuch für wenige cent in der Buchhandlung des Flughafens von Chicago gekauft. Huie war allen Einzelheiten dieses Falles nachgegangen, hatte zahlreiche Zeugen interviewt und schließlich das Urteil als einen klaren Justizmord darstellt. Sein Buch gab 1974 die Vorlage für einen Fernseh-Film mit dem gleichen Titel ab.
Es braucht kaum gesagt zu werden, was Grothendieck an diesem Fall so nachhaltig beeindruckt hat: die absolute Ablehnung des Krieges und die Bereitschaft, alle Konsequenzen der eigenen Überzeugung auf sich zu nehmen. Aber vor allem war es die Tatsache, dass Slovik ein ganz „gewöhnlicher“ Mensch war, ein Mensch, der in seiner Jugend auf die schiefe Bahn geraten war, wegen Autodiebstahl, Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und ähnliche Delikte vorbestraft war, ein Mensch ohne besondere Bildung, ohne Ideale, vielleicht ungläubig.
9. Die Matrix der Themen
Wie schon gesagt, diskutiert Grothendieck das Verhältnis der mutants zu den zehn in Abschnitt 5 aufgelisteten Themen ganz systematisch, manchmal geradezu schematisch. Es geht ihm darum festzustellen, ob eine „positive“ Beziehung zwischen der jeweiligen Person und dem jeweiligen Aspekt besteht, die er dann auch noch der Stärke nach durch ++, + oder +? beschreibt. In manchen Fällen kann er dazu natürlich nichts sagen (zum Beispiel Riemanns Verhältnis zum Sex), aber dieses schematische Vorgehen führt zu einer gewissen Vollständigkeit.
Selbstverständlich kann man diese Art des Vorgehens in Frage stellen: Erscheint es nicht sinnvoller, eine historische Persönlichkeit, sei es Darwin, Whitman oder Gandhi, aus ihrer eigenen Biographie, aus ihrem eigenen Leben und Werk und auch aus der jeweiligen Zeit heraus zu sehen, zu beschreiben und zu verstehen, anstatt sie auf des Prokrustes-Bett dieser zehn vielleicht nicht geradezu willkürlichen, aber doch von außen herangetragenen Fragen zu zwingen? Es ist aber typisch für Grothendieck: Er setzt die Maßstäbe.
Wir geben jetzt – einige etwas willkürlich herausgegriffene – Beispiele, wie Grothendieck in dieser Diskussion vorgeht:
Kommen wir jetzt zur Rubrik „Wissenschaft“. Ich halte vorweg fest, dass unter meinen Mutanten fünf Wissenschaftler im eigentlichen Sinne sind:
Hahnemann, Darwin, Riemann, Freud, Teilhard.
Für diese stellt „die Wissenschaft“ zu mindestens einen wesentlichen Bestandteil der menschlichen Kultur und des menschlichen Erbes dar, und darüber hinaus ist wissenschaftliche Arbeit ein wesentlicher oder sogar der hauptsächliche Bestandteil ihres eigenen Lebens und ihrer Mission. Es gibt sieben weitere unter den Mutanten, die mir eine „positive Beziehung“ zu der Wissenschaft zu haben scheinen:
Whitman, Bucke, Kropotkin, Carpenter, Steiner, Légaut, Félix [Carrasquer].
Unter diesen hat Kropotkine eine Sonderstellung, denn auch er hat das Temperament und die Statur eines Wissenschaftlers im traditionellen Sinn. Ich habe ihn deshalb nicht in die Gruppe der fünf oben genannten eingereiht, denn seine Mission hat ihn auf Wege geleitet, die ihn von seiner wissenschaftlichen Berufung hinweg führten bis zum vollständigen Bruch mit dieser, was ohne Zweifel ein Kulminationspunkt seiner Existenz war und zugleich der Eintritt in seine eigentliche Mission.
Grothendieck schließt dann noch einige Bemerkungen zu Kropotkin und einigen anderen der genannten an und fährt dann folgendermaßen fort:
Mit anderen Worten, diese vier Männer [Hahnemann, Riemann, Carpenter, Steiner] sind die einzigen unter meinen Mutanten, bei denen ich eine intuitive Vorahnung einer anderen Wissenschaft erkennen kann, einer „Wissenschaft von morgen“ oder einer „spirituellen Wissenschaft“, die in einem oder zwei Jahrhunderten zur Welt kommen und einen großen Aufschwung nehmen wird. Ganz gewiss wird diese schon lange bevorstehende Geburt endlich für zukünftige Zeiten die große Erneuerung [Mutation] mit sich bringen ...
Von den fünf Mutanten, die unter der Rubrik „Wissenschaft“ noch nicht erwähnt wurden, lassen sich Râmakrishna und Neill dadurch vergleichen, dass sie vollständig neutral erscheinen und vermutlich vollständig desinteressiert sind am Für und Wider der Wissenschaft. Es bleiben schließlich drei Mutanten übrig, die man als entschieden „anti-wissenschaftlich“ ansehen kann (so wie wir früher drei „anti-religiöse“ gefunden haben [Kropotkin, Krishnamurti, Carrasquer]):
Gandhi, Guruji, Krishnamurti.
... Schließlich scheint mir, dass das Verhältnis von Gandhi zur Wissenschaft nicht so „negativ“ ist wie es erscheint und dass es mit einer tiefen Einsicht in den richtigen Platz der Wissenschaft in der menschlichen Gesellschaft und den tödlichen Gefahren, die sie für unsere Art mit sich bringt, verbunden ist. ... Dies ist ganz gewiss eine viel tiefere Einsicht, als wir sie bei dem Dutzend der „pro-Wissenschaft“ eingestellten Mutanten finden. ...
Die Einstellung von Guruji, die vermutlich durch die von Gandhi beeinflusst wurde, ist weniger nuanciert als dessen. Für ihn ist die „Wissenschaft“ gewissermaßen die Inkarnation des „Bösen“ schlechthin und in jedem Fall verantwortlich für alles Schlechte in der modernen Welt. In seinen Augen ist der wissenschaftliche Geist die Inkarnation des Zweifels (das große schwarze Untier aller Spirituellen!) ganz und gar entgegengesetzt dem religiösen Glauben ... Er sieht Darwin als eine Art theoretischen Machiavellisten an, als den großen Verantwortlichen dafür, dass in der menschlichen Gesellschaft „das Gesetz des Dschungels“ herrscht, ...
Vielleicht mögen diese Zeilen genügen, um einen kleinen Einblick in Grothendiecks Text, Diktion und Herangehensweise zu geben.
10. Charles Darwin
Es ist offenkundig, dass Grothendieck allen seinen Mutanten größte Bewunderung entgegenbringt – mit einer Ausnahme: Darwin. Oder vielleicht zutreffender ausgedrückt: Wenn und soweit er Darwin bewundert, geschieht dies auf der intellektuellen Ebene, nicht der emotionalen. Vielleicht hängt es mit dieser emotionalen Distanz zusammen, dass – meines Erachtens – die Abschnitte über Darwin die am leichtesten lesbaren und die „verständlichsten“ des ganzen Textes sind. Es wird berichtet, dass Grothendieck gegen Ende seiner Zeit am IHÉS sein Interesse der Biologie zuwandte, und vielleicht ist seine Darstellung des Werkes und der Bedeutung Darwins auch ein Nachklang dieser früheren Beschäftigung mit der Biologie.
Offensichtlich spürt Grothendieck selbst das Bedürfnis zu rechtfertigen, dass er überhaupt Darwin in die Liste der Mutanten aufgenommen hat, denn er beginnt seine Darstellung mit folgenden Worten (S. 650):
Wenn ich Darwin unter „meine Mutanten“ aufgenommen habe, dann ist es wegen des tiefwirkenden Einflusses, den seine Theorie der Evolution auf die Geschichte des Denkens überhaupt ausgeübt hat, und insbesondere auf die Vorstellung, die der Mensch sich von sich selbst macht, von seiner Geschichte und von seinem Platz im Reich des Lebenden. Es gibt im Verlauf unserer Geschichte ganz gewiss nur wenige Menschen, die einen Einfluss von ähnlicher Tragweite gehabt haben. In der modernen Zeit sehe ich sonst niemanden außer Freud (dessen Einfluss mir aber tiefer und noch entscheidender erscheint). Es ist wahr, dass unter der spirituellen Sichtweise, die ich hier einnehme, diese exzeptionelle Rolle Darwins es nicht zwingend verlangt, dass es gerechtfertigt ist, in ihm einen der „Mutanten“ zu sehen. ...
Es ist diese Vision von der Evolution, von diesem Baum des Lebens, der die ganze Vielfalt der Arten umfasst, der sprießt und Knospen treibt und sich seit dem Beginn der Welt des Lebenden entfaltet und der auch in diesem jetzigen Augenblick sprießt und Knospen treibt in einem Aufstieg ohne Ende und dessen Gesetze uns verborgen bleiben [échappent] – es ist diese Vision allein, die mir wichtig ist. Eine Vision, so einfach, dass ein Kind sie verstehen kann!
Vergleicht Grothendieck Darwin mit anderen Mutanten, dann wird er sofort kritisch:
Auch ist es nicht erstaunlich, dass für einen Fujii Guruji, dessen Mission die Achtung vor allem Seienden und allen Dingen ist, der Name Darwin synonym mit dem „Gesetz des Dschungels“ ist und den zutiefst verhängnisvollen Aspekt des Triumphes der „Wissenschaft“ verkörpert, ...
Es ist sicher kein Zufall, dass Darwin, der (anders als sein Landsmann und Zeitgenosse Carpenter) ein vollständig eingebundenes Mitglied der Gesellschaft war und die sozialen Vorurteile seiner Zeit teilte, vor allem die Konkurrenz als hauptsächlichen Faktor der Evolution ansah, in einer Gesellschaft, die selbst grausam kompetitiv war. Dies ist ganz klar die Stelle, wo man eine spirituelle Unreife sieht, einen Mangel an innerer Autonomie gegenüber dem „Zeitgeist“ ...
Es erscheint nach diesen Zitaten ziemlich offensichtlich, warum Grothendieck trotz aller Bedenken und aller Kritik Darwin in seine Liste der Mutanten aufgenommen hat: Der von Darwin „entdeckte“ unermessliche „Baum des Lebens“, der alles Leben umfasst von den ersten Anfängen in einer unergründlichen Vergangenheit bis zur Gegenwart und zum Ende der Welt, das eines Tages kommen wird, dieser Baum gewinnt in seiner Unermesslichkeit eine mystische Qualität:
Denkt man an Darwin und an die Evolution, so denkt man auch an den Baum der Evolution (auch „phylogenetischer Baum“ genannt) – diesen gigantischen Baum von allen Pflanzen- und Tierarten gebildet, vergangenen und gegenwärtigen, die einen und die anderen hervorgegangen aus demselben gemeinsamen Stamm, der unzählige Generationen von Arten umfasst, die alle ... ; ein Baum, in dem unsere fragile und hochmütige Art nur ein letztes dünnes Zweiglein ist in der Überfülle der wuchernden Äste und Ästchen, der Zweige und Zweiglein, die knospen und austreiben und sich verzweigen im Verlauf der Unendlichkeit von Tausenden und Tausenden von Jahrtausenden.
Und Grothendieck hat ja sicher auch recht, wenn er feststellt, dass niemand mehr das heutige Menschenbild geformt hat als Darwin und Freud.
11. Sigmund Freud
Sigmund Freud (1856 – 1939) wird in Les Mutants als letzter ausführlich behandelt; die letzten 30 Seiten des Textes sind ihm gewidmet. Er nimmt in besonderer Weise eine Sonderstellung ein und zwar deshalb, weil er als Begründer der Psychoanalyse als erster das Phänomen des Traumes mit (von ihm selbst erfundenen) wissenschaftlichen Methoden untersucht hat und weil er als Arzt und Psychiater etwas zu sagen hat zu den Problemen und traumatischen Erlebnissen Grothendiecks, die sicher einer der Anlässe für die Niederschrift von Les Mutants gewesen sind.
Zu Beginn der Abschnitte über Freud (ab S. 660) schreibt Grothendieck, dass er zunächst Freud gegenüber besonders kritisch eingestellt war und sich bis vor kurzem niemals hätte vorstellen können, ihn bei seinen Reflexionen zu berücksichtigen. Er kannte Freud nur so gut oder so schlecht, wie ein gebildeter Mensch Freud eben kennt, mehr vom Hörensagen als auf Grund eigener Lektüre. Dann schreibt er jedoch:
C´est au cours de la réflexion poursuivie dans La Clef de Songes que ma relation à Freud et l´image que je me fais de lui ont enfin changé. La première occasion où j´évoque la pensée de Freud se place dès les tout-débuts, au lendemain même du jour où je commence ce livre, …
Tatsächlich hatte Grothendieck sich kurz zuvor die Studienausgabe des Fischer-Verlages von Freuds Werken beschafft. Er hat sie jedoch, wie er selbst sagt, nicht wirklich gründlich gelesen, sondern schreibt gelegentlich, dass er hoffe, eines Tages Zeit für eine sorgfältige Lektüre der Traumdeutung zu finden.
Grothendieck geht überhaupt nicht auf das Leben Freuds ein, und er fasst seine wichtigsten wissenschaftlichen Leistungen nur ganz kurz zusammen, wenn auch im Ton allerhöchster Bewunderung. Folgendes sieht Grothendieck als die bedeutendsten Leistungen Freuds an: Die Entdeckung des Unbewussten, die Entdeckung der Allgegenwart von Eros und Sexualität und die Theorie des Traumes und seiner (Be-)Deutung. Den Traum nennt er den Boten des Unbewussten.
La première grande idée de Freud concerne l´Inconscient. Tout d´abord l´existence même d´un Inconscient – d´une vaste partie immergée de la psyché, dérobée au regard conscient. D´autre part, l´omniprésence de cet Inconscient : l´Inconscient est partout, …
La deuxième idée de Freud que je voudrais évoquer concerne Eros, ou la pulsion érotique ou pulsion du sexe, ou encore (comme il l´appelait) « la libido ». … La grande idée nouvelle de Freud concernant Eros, et sa première grande découverte sur la psyché, est l´omniprésence d´Eros. … Eros est partout – et surtout là où on s´y attend le moins.
J´en viens à la troisième découverte cruciale de Freud, indissolublement liée aux précédentes. Elle concerne le rêve. … La grande découverte de Freud sur le rêve, c´est que le rêve est le messager par excellence de l´Inconscient. … La cœur même de sa doctrine nouvelle, c´est sa théorie du rêve.
An dieser Stelle drängt sich eine Frage auf, die unbeantwortet bleibt; man erkennt einen eklatanten Widerspruch, der nicht aufgelöst wird: In La Clef des Songes entwickelt Grothendieck selbst eine „Theorie“ des Traumes, deren zentrale Gedanken die folgenden sind: Erstens werden die Träume dem Menschen von einer äußeren Macht geschickt, und zweitens ist diese äußere Macht niemand anders als Gott selbst. Das erscheint nun so ziemlich als das genaue Gegenteil der naturwissenschaftlich-rationalen Theorie Freuds. Grothendieck kommentiert diesen Widerspruch (oder zumindestens Unterschied) mit keinem einzigen Wort; er scheint ihn überhaupt nicht zu bemerken. Ohne eine weitergehende Analyse des Textes muss im Augenblick offen bleiben, ob und wie Grothendieck diese beiden Sichtweisen des Traumgeschehens verbindet – oder auch neben einander bestehen lässt.
Wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt, der im Zusammenhang mit Freud erwähnt werden soll. Es ist Grothendieck durchaus klar, dass Freud als Psychiater etwas zu sagen hat, das für sein eigenes Leben von Relevanz sein könnte:
En ce qui concerne ces trois grandes idées fondamentales elles-mêmes ( … ), je peux dire que depuis bientôt douze ans que la méditation est entrée dans ma vie, j´ai ample occasion jour après jour d´en constater la validité, tant au cours du travail de méditation lui-même que par les observations quotidiennes de la vie de tous les jours. Ces « idées » se sont imposées à moi, non à partir de lectures théoretiques de Freud ou d´autres, mais d´emblée comme des réalités irrécusable, se révélant au contact de la réalité psychique elle-même, tant chez mois-même que chez autrui.
Im letzten Abschnitt des Textes mit dem bezeichnenden Titel „pulsion incestueuse et sublimation“ kommt Grothendieck dann auf ein Thema zu sprechen, das ihn sein Leben lang beschäftigt hat, das Inzest-Tabu, wobei es sich um Inzest zwischen Mutter und Sohn handelt. Er sagt ausdrücklich, dass in seinem Leben der (von Freud entdeckte) Ödipus-Komplex keine Rolle gespielt hat, dass es keinerlei Antagonismus im Verhältnis zu seinem Vater gegeben habe. Und er schreibt auch:
Mais chez l´homme comme chez la femme, la présence d´une pulsion incestueuse vers le parent de sexe opposé ne peut faire pour moi l´objet du moindre doute. Je soupconne que c´est là une pulsion universelle, indissolublement liée à la présence de l´archétype inné de la Mère et de celui du Père, dans l´Inconscient profond de la psyché humaine.
Wir erinnern uns daran, dass Grothendiecks erste Meditation – vielleicht eher ein dichterisches Werk – die Éloge d`Inceste war und dass er in seinen Schriften immer wieder auf das Verhältnis zu seiner Mutter, das offensichtlich von einer zerstörerischen Hass-Liebe gekennzeichnet war, zu sprechen gekommen ist. Der letzte Satz der Mutants ist:
Quant à l´humanité de demain, ou dans cent ou dans mille ans, je pressens qu´elle se distinguera de celle d´avant la Mutation par le fait que la pulsion incestueuse deviendra de plus en plus consciente, et que de plus (et en règle générale) sa sublimation se fera de facon de plus en plus aisée et plus en plus parfaite.
(Das wäre nun eine freudianische Ersatzhandlung wahrhaft überwältigenden Ausmaßes, wenn Grothendieck Les Mutants geschrieben und die Vision des Neuen Zeitalters heraufbeschworen hätte, um sich von dem Inzest-Tabu zu befreien.)
12. Schlussbemerkung
Ich möchte an dieser Stelle meine vorläufige Besprechung der Meditation Les Mutants beenden. Die von mir getroffene Auswahl von Themen und Zitaten ist mit Sicherheit willkürlich und zufällig. Es geht mir vor allem darum festzuhalten, dass Grothendieck philosophische Texte geschrieben hat, die einen anderen Charakter haben als Recoltes et Semailles und La Clef des Songes. In Les Mutants spürt man kaum etwas von der Agressivität und der streckenweise ans Paranoide grenzende Verbitterung von Recoltes et Semailles und auch nichts von der Ich-Bezogenheit, die in La Clef des Songes über weite Strecken dominiert. Man lernt einen Grothendieck kennen, der auf der Suche ist nach Vorbildern, nach Menschen, die ein Beispiel sind für das, was Mensch-Sein bedeutet.
Es bleibt offen, was Les Mutants eigentlich ist: Das habituelle Selbstgespräch eines wahnhaft Erkrankten, eine philosophische Meditation über die Bestimmung des Menschen, eine apokalyptische Vision von einem Neuen Zeitalter oder eine Art von Literatur, für die es kein Vorbild gibt.
Inscription à :
Articles (Atom)
Archives du blog
-
▼
2008
(260)
-
▼
mai
(79)
- Adaptation to hypoxia, tumor survival, hypoxia-ind...
- http://www.paese-serenu.com/de/
- Residence Paese Serenu, France, Corse, Porto-Vecch...
- 6 (mauvaises) raisons de ne pas prendre de complém...
- ecce homo
- Clinton, You Invoked a Political Nightmare ..... W...
- Morals ? Which Morals ? When Survival of the Jewi...
- Mr LOVE .... Reggie LOVE ....
- cu Lissandru, 23 05 2008, 13 H, sotto u laggu d'Or...
- WAR AGAINST CO². Basic fossil fuel facts must be c...
- a rich design toolkit for mixing, separating, and ...
- Sans titre
- a message to Senator Hillary CLINTON
- in vitro profiling of biologic activity
- Sans titre
- Sans titre
- ecce homo
- self-portrait
- .... partis avant nous, toujours présents partout ...
- Pour Anastasia
- bye
- Tiny Bodies in a Morgue, and Grief in China
- Important parallels with mechanisms of tumor vascu...
- A divided nation ? racism in the West Virginia ......
- Sans titre
- Sans titre
- Les bisphénols A peuvent être dangereux pour la sa...
- Durée du travail en France : un mensonge d'Etat
- renversé
- COMBIEN VAUT UN ENFANT ? ou les « Miles » et une f...
- ROUEN 2008, ASSISES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE GYN...
- Prof. Dr. Winfried Scharlau : "A preliminary essay...
- Air Pollution and Thrombosis
- the interactome
- Race as biology is fiction, racism as a social pro...
- A human rights crime, Jimmy Carter, former preside...
- .... the air we share ... l'air qu'on partage .......
- Dip in brainpower may follow drop in real power .....
- "parlons net"... une vision lucide du monde d'aujo...
- BACH. BWV - 1006 - John Williams
- PROJECT ZERO
- Is it an animal? Is it a human face? Fast processi...
- a pathway by which an endogenous cell-fate determi...
- lettera....
- La fin de notre civilisation est elle proche et in...
- L'Assemblée lève le tabou des langues régionales l...
- Orange,Théâtre Antique, July 7, 1973..... Tristan ...
- USA : 18 veterans a day commit suicide, four or fi...
- "Bleu univers" de Tarek Issaoui par Akram Belkaïd
- Effet innatendu de la "guerre post-moderne" : 18 s...
- Translation de centre de gravité
- Rising Above the Gathering Storm: Energizing and E...
- "The devil is at work everywhere in our universe.....
- Les maths sont ce qu'il y a de plus facile à compr...
- a mechanism capable of producing new kinds of RNAs...
- imagerie par lancer de rayons
- the greatest extinction risks from global warming ...
- specific alterations in neuronal architecture and ...
- Genomic and epigenetic alterations deregulate micr...
- wake up
- PEACE, SHALOM, MIR, SALAM, FRIEDEN, PACE, PACE, PA...
- musique : (2002) Craig Armstrong
- Six Crises That Jostle the World...la nature multi...
- Mathematik In höheren Dimensionen .....Eine Hommag...
- d'aprés Alexandre Grothendieck, "UNIVERS FIXE" ET ...
- conséquences des éventuels bombardements sur l'Ira...
- just on the other side of the sea...near, very nea...
- Darcos le nul / censuré par l'oeil de Sarko !!!
- Censure
- Du changement à la crise
- NAISSANCE D'UNE NATION
- Jean Le Rond d'Alembert et Karl Friedrich Gauss.....
- collias, 01 05 08 .....
- arritti ti !!!
- Orient und Occident Sind nicht mehr zu trennen
- point de vue d'Edgar Pisani sur la crise alimentai...
- The Mask of Zorro !!!
- The bigger problem will be food.... Enjoy life whi...
- London.....a little time machine....
-
▼
mai
(79)
